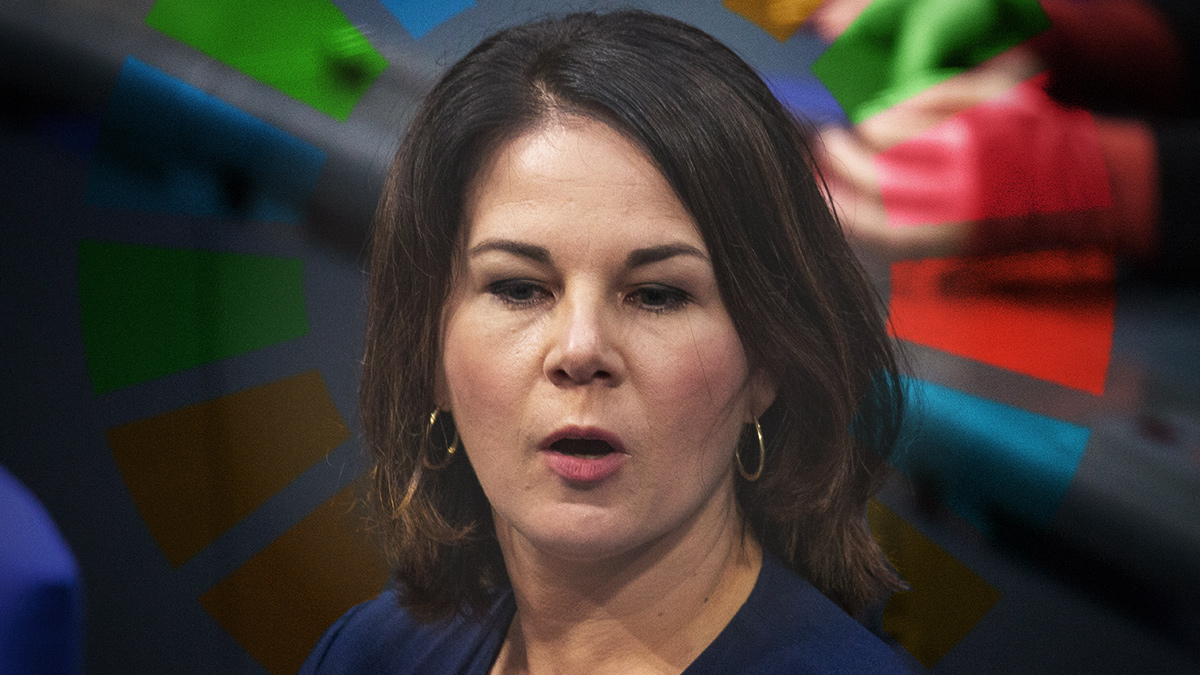Minute 04:00 – 09:48 und 17:11 – 21:12
In der Gesprächsrunde Talk im Hangar 7 des österreichischen Privatsenders Servus-TV, sprach der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther über die Auswirkungen der gegenwärtigen Angst – vor allem für Kinder. Die Angst der Erwachsenen sowie die Forderung an die Kinder, sich sozial zu isolieren und die darauffolgende Unterdrückung der natürlichen Kontaktbedürfnisse, führe zu irreversiblen Veränderungen im Hirn.
Gerald Hüther bemerkte, dass er sich von den alarmierenden Nachrichten nicht habe anstecken lassen, denn als Biologe wisse er, dass man ein Virus nicht kontrollieren und nicht besiegen könne. In der breiten Bevölkerung hätte die alarmistische Kommunikation jedoch etwas bewirkt. Die Menschen in unseren westlichen Industriestaaten seien sehr anfällig für Ängste geworden. Es gäbe bestimmte Ressourcen gegen die Angst, auf die man zurückgreifen könne, vor allem das Vertrauen in die eigenen Kompetenzen. Hüther bezweifelt, dass dieses Vertrauen noch gut ausgeprägt ist, da man heute jedes Problem durch entsprechende Dienstleister erledigen könne.
Es existiere grundsätzlich das Vertrauen, jemanden zu finden mit dem man das Problem gemeinsam lösen könnte, doch auch in dieser Beziehung ist Hüther skeptisch. Wir hätten zwar viele Beziehungen doch wenig Leute, auf die wir uns verlassen könnten. Das sei auch schwierig in einer Gesellschaft, in der wir uns gegenseitig als Konkurrenten sehen und in der wir die sozialen Beziehungen sehr stark durch unser individualistisches Weltbild bestimmen würden.
Wenn diese Zuversicht nicht mehr existiere, dann bleibe vielleicht noch das Vertrauen, in dieser Welt gehalten zu sein, was man früher «Gottes schützende Hand» nannte, meint Hüther. Wir müssten uns damit abfinden, dass das Ausmass an Angst, das jemand empfindet, ein subjektives Geschehen ist. Es hänge von der Einschätzung ab, wie stark etwas beurteilt werde, wie gefährlich es sei, und wie gross die Ressourcen, die dem betroffenen zur Verfügung stünden.
Der Neurobiologe sagt, dass der Boden für die geschilderten Entwicklungen schon vor der Covid-Krise vorbereitet wurde, um mit so einer schwierigen Situation definitiv nicht umgehen zu können.
Hüther mahnt zur Vorsicht mit dem Wort «Solidarität» in Bezug auf das Einhalten der Massnahmen. Man könne natürlich Menschen für den Zusammenhalt in Angst und Schrecken versetzen. Auch in einer anderen Notsituation, zum Beispiel bei einer Flut, würden die Menschen zusammenhalten. Doch das sei keine richtige Solidarität, sodern einfach nur ein Zusammenhalten, um ein Problem gemeinsam lösen zu können. Diese Menschen würden nachher wieder auseinanderfallen.
«Solidarität heisst, ich kann mich auf den anderen verlassen, ich weiss dass wir eine Gemeinschaft sind und dass wir bestimmte Probleme gemeinsam lösen können, und nicht, ich halte mal zusammen weil im Augenblick gerade irgendwas ist und anschließend rennen wir wieder auseinander. Es geht ja um ein Gefühl, ob man in einer Gesellschaft lebt, wo man sich auf andere verlassen kann oder auch nicht.»
Hüther fügt hinzu, dass viele Menschen sich offenbar auch schon vor «Corona» nicht auf alles verlassen wollten, was ihnen die Politiker erzählten. Diese hätten sich in den letzten paar Jahrzehnten auch nicht mit Ruhm bekleckert, deswegen existiere in Führungspersönlichkeiten ein gewisses Misstrauen.
All diese schon vorher existierende Entwicklungen würden jetzt viel stärker in Erscheinung treten und sich auch materiell bemerkbar machen, konstatiert Hüther. Laut einer eben veröffentlichten Studie aus Hamburg-Eppendorf sei jedes dritte Kind in Deutschland behandlungsbedürftig.
Es hätte auch vorher viele Kinder gegeben, die mit dem Problem nicht zurechtgekommen seien, doch bisher seien diese Kinder zusammen mit ihrem Problem in die Welt hinausgegangen, in die Schule, in die Pfarreien, in Vereine, und irgendjemand hätte sie dort gesehen und dem Kind vielleicht helfen können oder er hätte jemandem Bescheid sagen können. Das sei jetzt alles weg, bemerkt Hüther warnend, die Kinder seien nun mit ihren Problemen alleine gelassen. Es sei kein Wunder, dass sie alle durchdrehen würden.
Auf Argumente in der Runde, dass wir es eher mit Hysterie denn mit ernsten langfristigen psychischen Problemen zu tun hätten, wendet der Hirnforscher ein, dass wir aufpassen müssten, nicht so tun, als gäbe es hier die Angst und dort die Pathologie, bei der man eine Angststörung habe. Es wäre schön, wenn wir erkennen könnten, dass Menschen die Angst brauchen, so Hüther, denn sonst würden wir die sinnlosesten Sachen machen, doch wir würden keine Rückmeldung bekommen aus uns selbst heraus, dass wir etwas Falsches tun.
Die Angst sei auch ein Botschafter, der uns hilft herauszufinden und zu erkennen, dass man falsch unterwegs sei, fährt Hüther fort. In einer solchen Situation würden wir nach einer Lösung suchen. Das könne Verdrängen sein, oder etwas zu entwickeln. Es gäbe irrsinnig komplexe Lösungen, die die Menschen finden müssten, weil sie mit dieser Angst nicht zurechtkommen würden. Hüther interessiere nicht die in den psychotherapeutischen Behandlungen notwendigerweise erfolgende Therapie von Angststörungen, ihn interessiere was mit einer Bevölkerung passiert, die in diese Angst gerät und dann Lösungen suchen muss.
Mit anderen gemeinsam Spielen sei das natürlichste was ein Kind machen könne. Doch genau dies könnten sie jetzt nicht mehr. Ein lebendiges Bedürfnis nicht mehr stillen zu können, bedeute auch eine Art von Angst. Gewöhnung sei allerdings für Kinder keine Lösung, denn das Hirn sei ein aktives Organ, welches kreativ arbeiten wolle. Hüther weiter:
«Die Lösung heisst, das Kind versucht dieses Bedürfnis mit anderen zu spielen oder mit der Oma zu kuscheln, zu unterdrücken. Das ist sehr anstrengend und das merkt man den Kindern auch an, dass es ihnen nicht so leicht fällt. Dann bildet sich im Hirn eine Verschaltung, die diese Bedürfnisnetzwerke die das hervorbringen überbaut und hemmt, das ist die Lösung.»
Auf die Frage des Moderators, ob man das wieder aufschalten könne, antwortet Hüther:
«da können sie den Lockdown aufheben und dann will das Kind gar nicht mehr mit der Oma»,
Gerald Hüther unterstreicht, dass diese Reaktion nicht individuell ist, sondern ein kollektives Phänomen, natürlich abhängig davon, wie sehr ein Kind sich jetzt bemühen würde durch unsere Erwartungshaltungen allem gerecht zu werden. Es gäbe Kinder, die würden alles so perfekt machen, dass sie dann im Fernsehen gelobt würden, dass sie es besser machen würden als der Arzt. Hüther sagt schockiert, dass ihm da die Haare zu Berge stehen, denn das sei ja ein Zeichen, dass das Kind ganz besonders gut gelernt habe, seine natürlichen lebendigen Impulse so zu unterdrücken, dass nichts mehr übrig bliebe.
«Das Kind lernt zu funktionieren, und funktionieren kann man dann am besten, wenn man keine Bedürfnisse mehr hat. Unsere digitalen Roboter und Automaten funktionieren deshalb so gut, weil die keine Bedürfnisse haben. Das heisst, unsere Kinder werden dann solchen Robotern und Automaten immer ähnlicher und denen kann man dann sagen, setz die Maske auf, mach das und mach dies. Ich habe Angst vor so einer Gesellschaft, in der eine ganze Generation mit der Erfahrung heranwächst, dass sie nicht so sein dürfen wie sie sind, sondern sich gegenseitig eine irrsinnige Mühe geben, so zu sein damit sie unsere Erwartungen erfüllen, weil wir Angst vor Corona haben.»