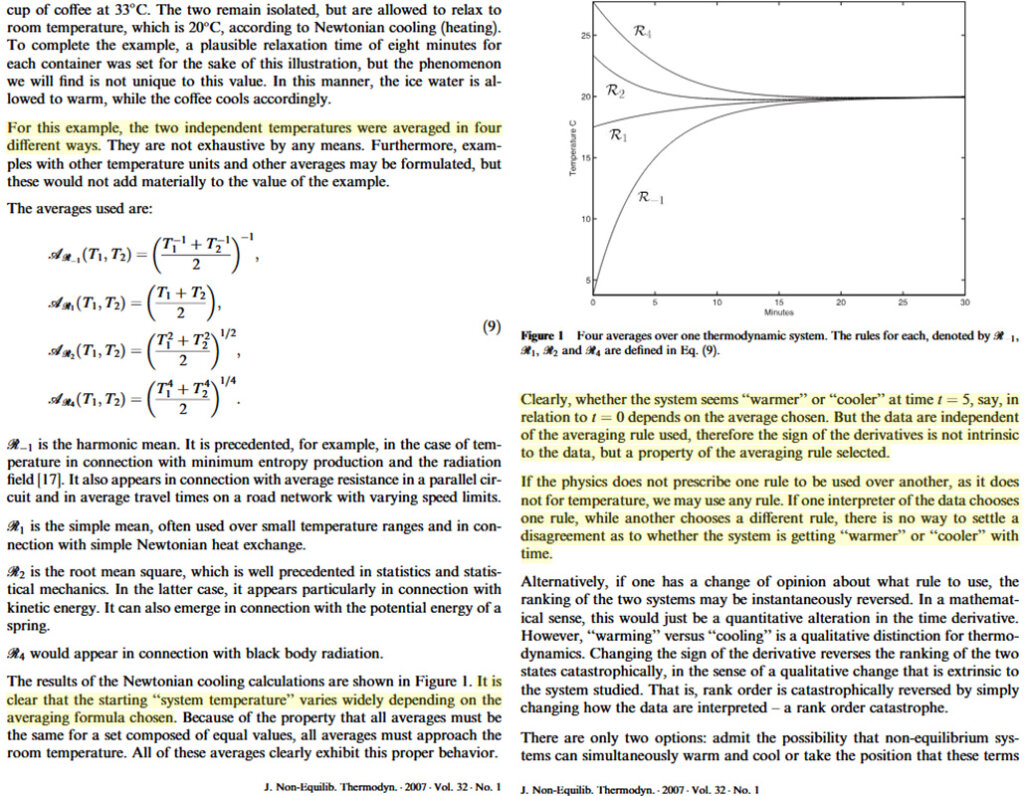Sehen wir ein Machtspiel, im Zuge dessen die Bürger lernen sollen, ihren eigenen sprachlichen Intuitionen zu misstrauen? Verwandelt sich die gemeinsame Sprache von einem Allgemeingut quasi zum Eigentum einer selbsternannten “sprachsensiblen” Sprachelite, die künftig über richtig und falsch in der Sprache bestimmt? Ist Toleranz gegenüber jeweils Andersdenkenden der Schlüssel beim aktuellen Sprachstreit? Der Professor für germanistische Linguistik Ralf Vogel hat zu dem Themenkomplex des Genderns einige Gedanken aufgeschrieben.
Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
Zum Autor: Ralf Vogel ist Professor für germanistische Linguistik an der Universität Bielefeld
Ich habe mich seit meiner friedensbewegten Jugend Anfang der 80er Jahre im politisch linken Spektrum verortet, von dem aus ich auch sprachpolitische Maßnahmen zu bewerten versuche.
Sogenanntes Gendern ist aktuell zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses geworden. Es ist eine sprachpolitische Maßnahme und somit auch völlig zurecht Gegenstand eines politischen Diskurses, für den die Linguistik keine Deutungshoheit beanspruchen kann. Ich glaube trotzdem, aus einer differenzierteren linguistischen Perspektive hilfreiche Denkanstöße geben zu können. Ich bin allerdings auch einer der Unterzeichner des Aufrufs gegen das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR) , und insofern nicht neutral.
Sprachwissenschaftler sind es gewohnt, ihren Gegenstand und ihre Disziplin als unpolitisch zu betrachten. Ich denke, dass das in beiden Fällen ein Trugschluss ist. Sicher, Sprache wird von uns als quasi naturgegebener Gegenstand angesehen und die theoretischen Vorstellungen, die man über die Beugung des Verbs, über Kasus, Numerus oder Genus entwickelt, sind, sofern sie wissenschaftlich sind, tatsächlich frei von gesellschaftsideologischen Aspekten.
In der Geschichte der Linguistik war dies nicht immer so. In Grammatiken des Deutschen aus dem 18. Jahrhundert oder von noch früher findet sich meist eine Mischung aus Beschreibung und Bewertung, dergestalt dass Variantenvielfalt in der deutschen Sprache beschrieben wird, aber gleichzeitig klar gesagt wird, welche Varianten nicht schicklich seien, meist verbunden mit einem verächtlichen Zungenschlag gegenüber den vermeintlich ungebildeten Schichten, Handwerker, Bauern usw. Im 19. Jahrhundert findet sich parallel zur Restauration des deutschen Nationalstaats auch eine Linguistik, die die deutsche Sprache zu einem Organismus aufwertet. Hier ist der Ursprung der sprachideologischen Haltung, die jeden Sprachwandel als Sprachverfall deutet, und die Übernahme von Lehnwörtern als eine Art Verschmutzung der ursprünglich reinen deutschen Sprache. Die moderne Linguistik enthält sich seither solcher Wertungen.
Vielmehr, und auch das ist eine politisch relevante Haltung, achten wir die Vielfalt der Sprachen auf der Welt. Alle Sprachen gelten uns gleich viel. Diese Haltung ist heute eine unabdingbare Grundlage jeder linguistischen Betätigung. Und dies hat auch seine politische Entsprechung erhalten beispielsweise im Diskriminierungsverbot aufgrund von Sprache im Grundgesetz, wie auch in der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats , die besonderes Augenmerk auf die innere Mehrsprachigkeit vieler Gesellschaften legt.
Gleiches gilt für uns aber auch für die Ausdrucksvielfalt innerhalb einer einzigen Sprache. Man kann „Sonnabend“ oder „Samstag“ sagen. Beide Ausdrucksweisen sind gleich viel wert. Und darin stimmen wir mit den Trägern der Sprache, den Menschen, die sie verwenden und denen sie folglich gehört, überein. Frei nach Rosa Luxemberg könnte man daher ein Prinzip des sprachlichen Pluralismus formulieren: Freiheit ist immer die Freiheit des Anderssprechenden. Nennen wir es das linguistische Rosa-Prinzip, oder im Folgenden einfach Rosa-Prinzip. Ich mag dieses Prinzip auch deshalb, weil es einem eine Haltung abverlangt, die jenseits der Frontlinien der Gendern-Debatte liegt.
Die menschliche Sprachfähigkeit beinhaltet ganz wesentlich die Fähigkeit des Menschen, sich verständigen zu können, obwohl man nicht genau die gleiche Sprache spricht, was praktisch immer der Fall ist. Unser sprachlicher Alltag besteht tatsächlich darin, dass wir die vielfältige Realität unserer Sprache vollumfänglich anerkennen und mit ihr problemlos umgehen. Wir können das und machen das, ohne dass es uns groß bewusst würde. Eine gemeinsame Sprache zu haben heißt demnach, einander zu verstehen, obwohl man keine gemeinsame Sprache hat.
Sprache im Alltag ist also echter gelebter Pluralismus. Wer im Übrigen nach Anschauungsmaterial für gelebten innersprachlichen Pluralismus sucht, der kann im vielgescholtenen ÖRR immerhin doch auch ein hervorragendes Beispiel finden. Ich meine die ZDF-Sendung Bares für Rares, in der Wertschätzung in jeder Hinsicht Programm ist. Überzeugen Sie sich selbst.
Ist das Rosa-Prinzip ein linkes Prinzip? Ich würde denken, ja – eines von vielen natürlich, aber wer sich nicht daran hält, kann eigentlich nicht für sich beanspruchen, links zu sein.
Das Rosa-Prinzip hat eine weitere Konsequenz: wer die Ausdrucksweise eines anderen nicht akzeptiert, versucht sich über ihn zu stellen. Da die Abschaffung von Herrschaftsverhältnissen zwischen Menschen ein linkes Ziel ist, ist diese Selbsterhöhung wiederum nicht links.
Sprachliche Freiheit, sprachliche Gleichheit in Vielfalt: Gibt es auch sprachliche Brüderlichkeit? Ja, auch das kann man aus dem Rosa-Prinzip indirekt herauslesen. Hier geht es um sprachliche Bedeutung und um den wichtigsten Beitrag, den die Linguistik in der Debatte leisten kann.
Eine Sprache ist ein Zeichensystem, bei dem grundsätzlich willkürlich Formen und Bedeutungen zu Zeichen verbunden werden. Aber diese Verbindungen, einmal gesetzt, definieren dann die Sprache. Ein Fisch ist ein Fisch und ein Tisch ist ein Tisch, und wer die beiden Wörter verwechselt, wendet die Sprache falsch an. Dass dem so ist, ist eine soziale Tatsache, wie überhaupt alle sprachlichen Tatsachen soziale Tatsachen sind. Es liegt außerhalb der Macht des Einzelnen, zu erwirken, dass ein Fisch künftig in der Gemeinschaft als Tisch bezeichnet wird. Versuchen Sie es. Das Inventar einer Sprache stellt sich im Rahmen einer ungesteuerten sozialen Dynamik ein, die auf der unentwegten kommunikativen Tätigkeit der Gesellschaft beruht. Für die deutsche Sprache sprechen wir hier von über 100 Millionen Menschen. Die Sprache wird in diesem Rahmen auch kontinuierlich verändert.
Gleichwohl sind diese konventionalisierten sprachlichen Zeichen nur Werkzeuge der Kommunikation. Wir verwenden diese Werkzeuge, um uns auszutauschen, also Bedeutungen, Ideen, Vorstellungen, Wünsche usw. zu kommunizieren. Was dabei für den Adressaten einer Äußerung zählt, ist nicht, was die verwendeten Wörter konventionell bedeuten, sondern was der Sprecher mit der Verwendung dieser Wörter meint, was er versucht zu kommunizieren.
Wenn Sie sich oben gefragt haben, wie es gelingt, einander zu verstehen, ohne die gleiche Sprache zu haben, dann liegt hier die Antwort: Eine streng genommen gemeinsame Sprache ist nicht nötig, weil gelingende Kommunikation davon nicht abhängt. Die sprachlichen Zeichen sind beim Verstehen einer Äußerung eher so etwas wie Anhaltspunkte.
Das Wesen des Verstehens liegt also darin, zu erkennen, was jemand mit einer Äußerung meint, nicht in dem, was die verwendeten Wörter hergeben, wenn sie quasi wortwörtlich verstanden werden. Wenn es anders wäre, könnte es sprachkreative Erscheinungen wie beispielsweise Metaphern gar nicht geben, keinen Sprachwandel, generell keine sprachlichen Neuerungen, aber damit auch keine Sprache, weil alle Einheiten der Sprache irgendwann einmal als Neuerungen in die Sprache aufgenommen wurden. Das ist also auch wieder ein fundamentaler Aspekt der Sprache.
Das Prinzip, das ich hier beschrieben habe, besteht darin, dass in der alltäglichen zwischenmenschlichen Kommunikation dem Verstehen dessen, was das Gegenüber meint, Vorrang gegeben wird gegenüber dem, was andere oder man selbst mit derselben Wortwahl meinen würden, oder was sich in einer anderen Situation an gemeinter Bedeutung ergäbe.
Verstehen beruht also auf Empathie. Auch diese sprachliche Brüderlichkeit ist eine Konsequenz des Rosa-Prinzips, die sich allerdings wie gesagt erst ergibt, wenn man die Eigenarten sprachlicher Kommunikation berücksichtigt. Umgekehrt gilt dann auch, dass mein Verlangen, dass eine Person auf eine bestimmte Weise zu mir spricht, einen Eingriff in deren Ausdrucksfreiheit darstellen würde, also einen Verstoß gegen das Rosa-Prinzip.
Ob eine sprachpolitische Maßnahme links ist, kann man nun daran festzustellen versuchen, ob sie dem Rosa-Prinzip gerecht wird: also Vielfalt achten, keine Selbstüberhöhung, Einfühlung. Eigentlich ganz einfach.
Sind Linke dafür anfällig, gegen das Rosa-Prinzip zu verstoßen? Eindeutig ja. Es gab mal eine Zeit, in der Befürworter und Gegner einer Technologie, nennen wir sie behelfsweise mal Atomkernkraft, an ihrer Bezeichnung für diese Technologie erkennbar waren, wie eine Art sprachliches Parteiabzeichen.
Das hatte etwas Praktisches, hatte aber die Nebenwirkung, dass man sich auf der Linken skurrile Erklärungen für die eigene Ausdruckspräferenz ausdachte wie dass Kernkraft harmloser klänge als Atomkraft, weil Atomkraft an Atombombe erinnert – und Kernkraft nicht an Kernwaffen, sondern an Apfelkerne oder so. Das Lächerliche daran ist rückblickend die Verwechslung von Narrativen und ihrer Propagandasprache mit der Realität. Beide Parteien hätten sich ja auf eine gemeinsame Bezeichnung einigen können, wie das in den meisten anderen Politikfeldern auch der Fall ist. Und das hätte die Kontroverse in keiner Weise beeinflusst.
Der linke Verstoß gegen das Rosa-Prinzip besteht hier in der Nicht-Akzeptanz des Ausdrucks Kernkraft. Der Verständigung tat das Ganze im Übrigen aber keinen Abbruch. Schließlich kann man sich nicht streiten, wenn man sich nicht versteht.
Nehmen wir noch ein anderes Beispiel, bevor wir zum Gendern kommen. Im Zuge der Flüchtlingskrise der EU wurde von Seiten der Aktivisten Geflüchtete/r als neue Bezeichnung anstelle von Flüchtling eingeführt. Das am Beispiel Atom-/Kernkraft beschriebene Muster wiederholt sich hier. Man kann wieder Vertreter einer bestimmten politischen Position an der Ausdrucksweise erkennen.
Das Problem mit dem linken Aktivismus ist aber auch hier, dass er das Bedürfnis nach einer Begründung hat, die auch hier darauf basiert, die nicht verwendete Alternative schlecht zu reden. Flüchtling soll irgendwie verächtlich oder diskriminierend klingen, was auch an der Endung -ling liegen soll wie in Häftling, Schwächling. Erneut sehen wir selektive Wahrnehmung: Varianten, die nicht in die Argumentation passen, wie Säugling, Zwilling, Liebling, werden ausgeblendet. Dass hier mit der Verwendung des Partizips auch eine Strategie des Genderns angewandt wird, mag eine weitere Motivation für die Ausdrucksweise sein.
Grundsätzlich, und das ist beim Gendern auch so, versucht hier eine Minderheit, der Mehrheit ihr Sprachgefühl aufzuzwingen: “Ich empfinde Flüchtling als diskriminierend, und wenn du das nicht genauso fühlst, dann stimmt mit deinem Sprachgefühl etwas nicht.”
Wir sehen, wie hier ein Machtspiel beginnt, im Zuge dessen die Sprecher des Deutschen lernen sollen, ihren eigenen natürlichen sprachlichen Intuitionen zu misstrauen (eine Art „Gaslichtern“). Wer sich darauf einlässt, wird abhängig von den Empfehlungen von Experten, also den Aktivisten, und plötzlich verwandelt sich die gemeinsame Sprache von einem Allgemeingut quasi zum Eigentum einer selbsternannten “sprachsensiblen” Sprachelite, die künftig über richtig und falsch in der Sprache bestimmt.
Das ist allerdings eben nur eine theoretische Möglichkeit. Es gab schon so viele derartige Versuche, Sprache zu kapern. Sie sind alle jämmerlich gescheitert und das wird immer so sein. Deshalb kann man das ganze Gewese um Gendern und andere Sprachempfehlungen eigentlich auch ziemlich gelassen sehen.
Kommen wir nun zum Gendern. Wer mir bis hierher gefolgt ist, wird zunächst einmal schlussfolgern, dass eine neue Ausdrucksweise an sich nichts Schlechtes sein kann. Wer dem Rosa-Prinzip folgt, der kann sich weder gegenderter Ausdrucksweise verschließen, noch beispielsweise Anglizismen oder jugendsprachlicher und anderweitiger Sprachakrobatik. Aber Sie werden vielleicht ahnen, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Ich habe selbst eigentlich immer bestimmte unorthodoxe orthographische Mittel wie das Binnen-I verwendet, je nach Lust und Laune. Das Spiel mit den Ambivalenzen und Ausdrucksmöglichkeiten von Sprache und Schrift gehört zum sprachlichen Alltag und für viele von uns macht es den eigentlichen Spaß an der Beschäftigung mit Sprache aus.
In dem Moment aber, wo diese spielerische Praxis den politischen Raum betreten hat, war alle Unbefangenheit dahin. Das Gendern wurde zu einem sprachlichen Parteiabzeichen. Die Gleichstellungsbüros öffentlicher Instutionen verfassen Sprachratgeber, die als Empfehlungen tarnen, was mit empfindlichen sozialen Sanktionen bewehrt einer Forderung nach unbedingtem Sprachgehorsam entspricht.
Alternative Mittel, wie das landauf landab in allen Schichten und Regionen höchst gebräuchliche und vorrangig verwendete Mittel des sogenannten generischen Maskulinums, werden als diskriminierend diffamiert. Diejenigen, die mit Überzeugung gendern, tun das ausgesprochen demonstrativ und inszenieren sich als die besseren Menschen. Es ist offensichtlich, dass das Rosa-Prinzip hier gravierend verletzt ist. In mehreren Punkten.
Es beginnt aber damit, dass auch hier die Abwertung der Ausdrucksalternative keine Basis in der Realität hat. Nehmen wir eine Durchsage in einem Kaufhaus kurz vor Ladenschluss: Liebe Kunden, bitte beenden Sie zügig Ihren Einkauf. Wir schließen in fünf Minuten. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Das ist ganz gewöhnlicher Sprachgebrauch, wie er ständig im deutschen Sprachraum vorkommt. Niemand, auch keine Gendern-Befürworter, würde bestreiten, dass der hier verwendete Ausdruck Kunden geschlechtsneutral gemeint ist und dass das auch problemlos so verstanden wird. Das ist ein unbestreitbares linguistisches Faktum. Auch die weiblichen Kunden werden das Kaufhaus verlassen.
Jede Empfehlung, dass anstelle von Kunden Ausdrucksweisen wie Kund*innen oder Kundinnen und Kunden besser zu verwenden seien, und Kunden zu vermeiden, geht mit einer Verletzung des Rosa-Prinzips einher. Die Sprachvielfalt wird nicht geachtet; man stellt sich über diejenigen, die sich für das generische Maskulinum entscheiden; man weigert sich, den Ausdruck so zu verstehen – wie man ihn verstanden hat.
An dieser Stelle werden dann psycholinguistische Studien zitiert, die angeblich beweisen sollen, dass Ausdrücke wie Kunden von uns eben doch unbewusst (womit auch unterstellt wird: in Wirklichkeit, als ob das Unbewusste die Wirklichkeit wäre) als männlich interpretiert werden. Sehen wir einmal davon ab, dass die hier meist prominent genannten Studien nach meiner Einschätzung teils katastrophale methodische Fehler beinhalten, und dass die so “gemessenen” Effekte selten die klaren Schlussfolgerungen erlauben, die aus ihnen gezogen werden.
Das Grundproblem bleibt dabei das Folgende: Es ist überhaupt nicht zu erkennen, wieso solche vermeintlichen psychologischen Tatsachen für die Bewertung von Sprache relevant sein sollen, die wie gesagt primär ein soziales Phänomen ist.
Wenn es wirklich so wäre, dass wir uns bei der Verwendung generischer Maskulina ständig missverstehen, dann wäre uns das längst aufgefallen. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte aus der Beobachtung der tatsächlich stattfindenden Kommunikation, dass dem so wäre. Sprache ist nicht perfekt, und Missverständnisse kommen immer wieder vor, aber die generischen Maskulina sind hier in keiner Weise auffällig.
Es gibt also keinerlei Hinweise aus dem realen Sprachgebrauch, dass die deutsche Sprache an dieser Stelle reformbedürftig wäre. Ich wähle diesen Ausdruck hier bewusst, weil die gleiche Masche zu beobachten ist wie bei neoliberalen Reformen: man redet ein öffentliches Gut schlecht, das gut etabliert und sicher nicht perfekt ist, aber im Prinzip gut funktioniert. Und dann setzt man etwas an dessen Stelle, wobei man damit vorrangig ein Eigeninteresse bedient.
Ist der Antrieb der Akteure bei den neoliberalen Sozialreformen materieller Art, so ist für mich nicht offensichtlich, was hier der Antrieb ist, abgesehen davon, dass die Akteure, die das Gendern offensiv betreiben, sich als Teil einer Art sprachrevolutionärer Bewegung zu sehen scheinen, und ihre Befriedigung darin finden mögen, dass sie ach so viel Gutes tun. Klar ist, dass die Gendern-Aktivisten so etwas wie symbolische Macht oder Deutungshoheit über die gemeinsame Sprache beanspruchen.
Das Problem liegt also nicht in den sprachlichen Mitteln des Genderns an sich (jeder darf sich so ausdrücken wie er möchte), sondern darin, dass wir es hier mit einer sprachpolitischen Maßnahme zu tun haben, die gegen das Rosa-Prinzip verstößt, weil sie alternative Ausdrucksweisen und ihre Verwender diskriminiert.
Gegenstand unseres Protests gegen das Gendern sind also im Wesentlichen all die landauf landab verfassten Sprachratgeber bis hin zu Passagen in Gleichstellungsverordnungen, bei denen die Diskriminierung von Ausdrucksweisen und damit ihrer Verwender Programm ist. Die Adressaten des Protests sind die Gleichstellungsstellen, die diese Ratgeber und Richtlinien verfassen. Der ÖRR ist dabei eine dieser Institutionen, bei denen das nur besonders sichtbar wird, weil es sich eben um Medienanstalten handelt.
Wie gehe ich persönlich damit um? Ich bin zurückgekehrt zum generischen Maskulinum, konsequenter als je zuvor. Ich finde das öffentliche demonstrative Zurschaustellen von sprachlichen Parteinadeln abstoßend. Deshalb habe ich auch im Grunde keine andere Wahl. Und außerdem stehe ich schon aus Prinzip auf der Seite der Unterdrückten!
Was die interne Kommunikation an meinem Arbeitsplatz angeht, da bekenne ich mich zugleich zu einem hemmungslosen Opportunismus. Mir sind meine fachlichen und institutionellen Belange hundertmal wichtiger als ein Disput um unsinnige Sprachempfehlungen. Und genau deshalb kann ich gendern bis zum Umfallen, wenn ich möchte, dass übergeordnete Stellen meine Belange unterstützen.
Ok, auf Dauer ist das kein guter Zustand. Time will tell.
Titelbild: keport / Shutterstock