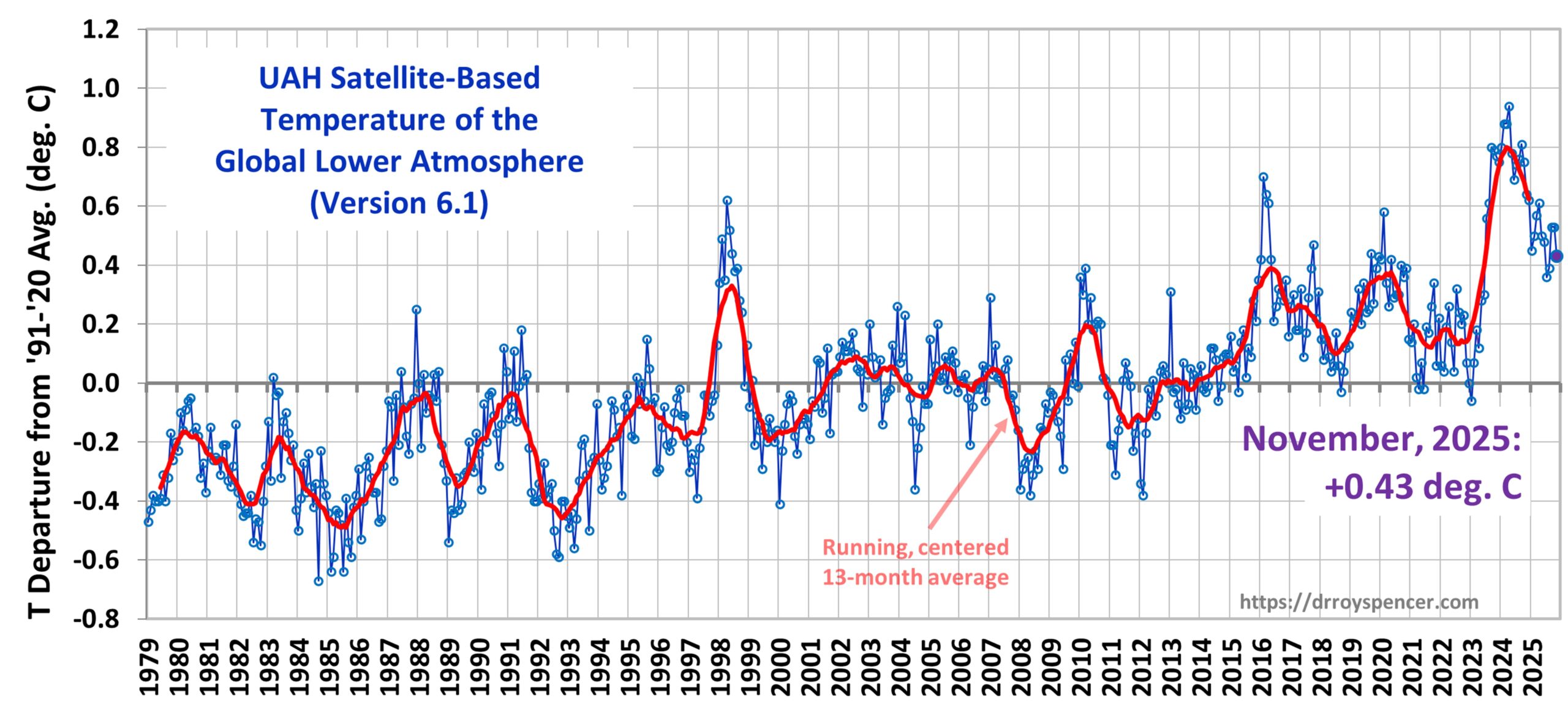In der EU gibt es keinen wirklichen Wettbewerb um den Strompreis, da sich die Preisgestaltung nach den teuersten Produzenten richtet. Jene die günstig produzieren können, fahren dafür unermessliche Milliardengewinne ein. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, Druck aus dem System zu nehmen und die Preise an den Strombörsen wieder zu normalisieren.
Eigentlich sollte es in Bezug auf die Strompreise klar sein: Wer günstig produziert, soll günstig verkaufen und wer teurer produziert ist faktisch nur ein Zulieferer in das Netz. Das ist eigentlich eine Marktwirtschaft, in der der Kompetitivere seine Preisvorteile zur Gewinnung von Kunden nutzen kann. Doch in der Europäischen Union gilt das Merit-Order-Prinzip. Das heißt: An den Strombörsen gibt es nämlich einen Einheitspreis – und dieser wird durch die teuerste Art (also die Grenzkosten) jener Stromerzeugung bestimmt, die gerade noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken.
Im Grunde genommen heißt dies: Alle Kraftwerke melden ihre Produktionspreise für ihre am nächsten Tag zu produzierende Strommenge. Wenn nun (als fiktives Rechenbeispiel) beispielsweise ein Bedarf für einen bestimmten Tag bei 100 MWh gemeldet wird und Kraftwerk A 48 MWh zu 100 Euro pro MWh, Kraftwerk B 33 MWh zu 150 Euro pro MWh, Kraftwerk C 17 MWh zu 200 Euro pro MWh liefert, wären das 98 MWh. Nun reicht dies jedoch nicht aus und Kraftwerk D (welches z.B. jetzt mit Gas läuft) muss zugeschaltet werden, um die fehlenden 2 MWh zu liefern. Doch der Preis dafür liegt bei 500 Euro pro KWh. Dann gilt der allgemeine Preis von 0,50 Euro pro KWh für allen an der Strombörse gehandelten Strom. Die Betreiber der Kraftwerke A, B und C fahren also enorme “Windfall-Profite” ein.
Ein Artikel beim “Focus” geht dazu ein, beschönigt aber die “Erneuerbaren Energien” (i.S.v. Solar- und Windenergie), indem diese mit Null Euro an Kosten dargestellt werden. Denn auch wenn die Sonne kostenlos scheint und der Wind auch kostenlos weht, gilt es dennoch betriebswirtschaftlich zu rechnen und die laufenden Kosten (Instandhaltung, Investitionen usw.) mit ein zu kalkulieren. Solarfarmen und Windparks errichten sich ja nicht zu Nullkosten und müssen ebenfalls ständig gewartet und betreut werden.
Im Grunde genommen haben wir die Strompreisexplosion also der Konstruktion des europäischen Strommarktes zu verdanken, in dem das alte Prinzip wonach der Produzent gleichzeitig auch der Lieferant ist über den Haufen geworfen wurde. Früher war es nämlich so, dass beispielsweise die Stadtwerke oder regionale Erzeuger ihre Kunden hatten und diese aus eigener Produktion versorgten. Gab es einen Überschuss an Strom, wurde dieser verkauft, bei einer Unterproduktion wurde dieser eingekauft. Mit der Energiewende kam jedoch eine Preisverwerfung, da die Einspeisung von Solar- und Windenergie sich nicht beliebig steuern lässt (jene von Atom-, Kohle-, Gas- und Wasserkraft jedoch weitestgehend schon), weshalb diese nun privilegiert in die Netze eingespeist wird.
Weil Gas nun extrem teuer ist, bestimmt jedoch der Gaspreis den gesamten Strompreis, obwohl nur rund fünf Prozent der gesamten Stromerzeugung davon abhängen. Ein Problem, das eben in Krisenzeiten wie diesen auftritt und welches geregelt werden muss, will man die Energiekrise nicht eskalieren lassen. Das heißt, theoretisch müsste es (ähnlich wie beim Länderfinanzausgleich in Deutschland) einen Pool geben, in dem die einzelnen Kraftwerke entsprechend ihren Grenzkosten einen bestimmten Betrag einzahlen bzw. erhalten. Im Sinne einer Milchmädchenrechnung (und auf Basis des obigen Beispiels) könnte dies wie folgt aussehen:
- Kraftwerk A produziert 48 MWh zu 100 Euro/MWh, also Kosten von 4.800 Euro – Strombörsenpreis: 24.000 Euro
- Kraftwerk B produziert 33 MWh zu 150 Euro/MWh, also Kosten von 4.950 Euro – Strombörsenpreis: 16.500 Euro
- Kraftwerk C produziert 17 MWh zu 200 Euro/MWh, also Kosten von 3.400 Euro – Strombörsenpreis: 8.500 Euro
- Kraftwerk D produziert 2 MWh zu 500 Euro/MWh, also Kosten von 1.000 Euro – Strombörsenpreis: 1.000 Euro
- Gesamt: 100 MWh zu durchschnittlich 141,50 Euro/MWh, also Kosten von 14.150 Euro – Strombörsenpreis: 50.000 Euro
Wie wir also sehen, liegt der Strombörsenpreis beim Dreieinhalbfachen dessen, was nach den realen durchschnittlichen Kosten eigentlich verlangt werden sollte. Um dies auszugleichen könnte Kraftwerk A 10 Euro/MWh, Kraftwerk B 7 Euro/MWh und Kraftwerk C 5 Euro/MwH in den Pool einzahlen, wodurch 480 plus 231 plus 85 Euro, also 796 Euro in den Topf kämen, der dann Kraftwerk D als Kostenausgleich zufließt. Dann sähe die Rechnung so aus:
- Kraftwerk A produziert 48 MWh zu 110 Euro/MWh, also Kosten von 5.280 Euro – Strombörsenpreis: 9.840 Euro
- Kraftwerk B produziert 33 MWh zu 157 Euro/MWh, also Kosten von 5.181 Euro – Strombörsenpreis: 6.755 Euro
- Kraftwerk C produziert 17 MWh zu 205 Euro/MWh, also Kosten von 3.485 Euro – Strombörsenpreis: 3.485 Euro
- Kraftwerk D produziert 2 MWh zu Euro/MWh, also Kosten von 204 Euro (= 1.000 – 796 aus dem Topf) – Strombörsenpreis: 410 Euro
- Gesamt: 100 MWh zu durchschnittlich 141,50 Euro/MWh, also Kosten von weiterhin 14.150 Euro – Strombörsenpreis: 20.490 Euro
Wie diese Beispielrechnung zeigt, orientiert sich der gesamte Strompreis dann an Kraftwerk C, welches mit 205 Euro dann die höchsten Grenzkosten aufweist. Zwar liegen die gesamten Kosten mit 20.950 Euro immer noch über den realen Erzeugergrenzkostenpreisen von 14.150 Euro, doch nur mehr bei knapp 42 Prozent dessen, was zuvor (50.000 Euro) verrechnet wurde. Wie gesagt, dies ist nur eine “Milchmädchenrechnung”, dennoch könnte ein solches Preisausgleichssystem zumindest etwas Druck aus solchen Spitzen nehmen.