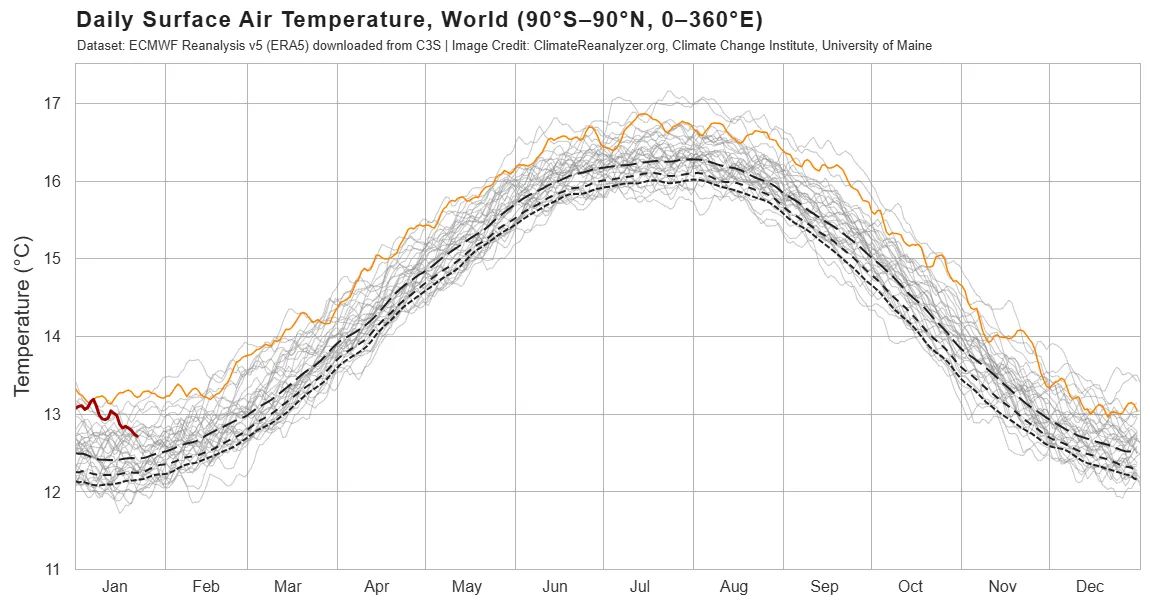Was soll man von Politikern halten, die nur reagieren und nicht vorausschauen können oder wollen, die erst Handeln, wenn das Kind bereits in den überlaufenden Brunnen gefallen ist.
Jetzt, wo alles zu spät ist, wo so viele Opfer gezählt werden müssen, wo der Bürger mal wieder zur Kasse gebeten wird, weil die Politik die Steuergelder lieber im Ausland versenkt, zaubern sie alle ihre tollen Vorschläge und Tipps aus dem Hut:
Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, hat die Bundesregierung aufgefordert, ihr Katastrophen-Informationssystem zu reformieren und die Bevölkerung per Textnachricht auf dem Mobiltelefon vor drohendem Unwetter zu warnen. „Die Hochwasserkatastrophe ist eine furchtbare Tragödie“, sagte Buschmann dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben). „Viel Leid hätte verhindert werden können, wenn die Opfer frühzeitig gewarnt worden wären.“
Er fügte hinzu: „Ich habe nichts gegen Sirenen. Aber eine Textnachricht aufs Smartphone kann viel präziser warnen.“ Die Bundesregierung müsse deshalb ihren Sonderweg beenden und wie andere Länder sowie die Europäische Union auf eine einfache Warntechnologie setzen.
„Mit Cell Broadcasting können konkrete Warnhinweise ohne Handynummern gezielt in betroffenen Gebieten verschickt werden.“ So ließen sich große Bevölkerungsteile einfach und schnell warnen und informieren. „Dazu bedarf es keiner neuen Technik und keiner App.“
Diese – von Experten befürwortete, aber teure – Technologie müsse jetzt konsequent genutzt werden. „Der Einsatz dieser Technologie hätte möglicherweise Menschenleben retten können.“
Hat der Typ noch nie was von Katwarn gehört, den gibt es schon lange auf dem Handy und der warnt bereits jetzt schon.
Auch die Grünen in NRW fordern, als Konsequenz aus den Katastrophenfällen nach dem Unwetter wieder Sirenen zur Warnung der Bevölkerung aufzustellen. „Es ist dringend notwendig, das System der Warnsirenen wieder aufzubauen“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Verena Schäffer, dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstagausgabe). „Das funktioniert natürlich nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger darüber aufgeklärt werden, welcher Warnton wie zu verstehen und wie darauf zu reagieren ist.“
Da es künftig wegen des Klimawandels häufiger Extremwetterereignisse geben werde, „müssen wir über Konsequenzen für den Katastrophenschutz diskutieren, dazu gehören unter anderem verpflichtende Katastrophenschutzbedarfspläne für die Städte und Kreise“. Vor den Überflutungen hätten die Unwetterwarnungen rechtzeitig vorgelegen. Es stelle sich die Frage, „wann genau das NRW-Innenministerium von den Unwetterwarnungen wusste und mit welchem Nachdruck es die Städte und Kreise als Katastrophenschutzbehörden zum Handeln aufgefordert hat.“
Der Vize-Präsident des CDU-nahen Wirtschaftsrats, Friedrich Merz, hat sich hingegen dafür ausgesprochen, beim Wiederaufbau der zerstörten Ortschaften in den Hochwassergebieten nicht alle Gebäude wieder an Ort und Stelle zu errichten und gefährdete Flächen künftig frei zu lassen. „Das Baugebiet muss dem Risiko angepasst werden, sonst laufen Hauseigentümer und Unternehmer Gefahr, beim nächsten Hochwasser wieder alles zu verlieren“, sagte der CDU-Politiker, der dem Unions-Wahlkampfteam angehört, dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben). „Das bedeutet, dass man in bestimmten Gebieten künftig nicht mehr bauen können wird.“
In der Vergangenheit sei „offensichtlich zu nah an den Wasserläufen gebaut worden“. Außerdem seien zu viele Wasserläufe begradigt worden. „Das muss man sich anschauen und Konsequenzen für den Wiederaufbau ziehen“, sagte Merz.
Es sei auch wichtig, Flussauen als Überschwemmungsraum auszubauen. „Dann gibt es deutlich weniger Hochwasserschäden.“
Hier weitere aktuelle Meldungen aus dem Katastrophengebiet Deutschland:
Versicherungsverband erwartet Rekordschaden nach Hochwasser
Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft, Jörg Asmussen, rechnet nach der Hochwasser-Katastrophe mit einem Rekordschaden. „Kurzfristig zeichnet sich ab, dass sich 2021 zu einem der schadenträchtigsten Jahre seit 2013 entwickeln könnte. Damals lag der versicherte Schaden bei 9,3 Milliarden Euro“, sagte Asmussen der „Rheinischen Post“ (Dienstagsausgabe).
„Wenn es nicht gelingt, die Erderwärmung unter dem Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimagipfels zu halten, dann werden wir etwa die Versicherung von Naturgefahren nicht in der bestehenden Form fortführen können.“ Asmussen wies darauf hin, dass viele Gebäude in Deutschland nicht gegen Elementarschäden wie Starkregen abgesichert seien: „Selbst in der höchsten Risikozone ist in Deutschland jedes vierte Haus gegen Hochwasser versichert – nur jedes vierte Haus, denn mehr wäre möglich: Nahezu alle Hausbesitzer in Deutschland konnten sich gegen Naturgefahren versichern und werden dies auch weiterhin können.“ Eine Pflichtversicherung lehnt der GDV-Chef dagegen ab: „Eine Pflichtversicherung ist nicht unbedingt eine nachhaltige Antwort auf die vor uns liegenden Herausforderungen.
Es mangelt in Deutschland ja nicht an Angeboten für Versicherungsschutz, sondern vielerorts eher an einem verantwortungsvollen Umgang mit Naturgefahren“, sagte Asmussen. „Wenn jeder Schaden in jedem Fall ersetzt wird, bleiben staatlicher und individueller Naturgefahrenschutz auf der Strecke.“ Asmussen forderte mehr Prävention: „Klimafolgen-Anpassung kommt vielerorts zu kurz. Noch immer wird in Überschwemmungsgebieten gebaut, werden Flächen ungehindert versiegelt, stauen sich auf kommunaler Ebene Investitionen in Präventionsmaßnahmen. Hier gilt es umzusteuern, sonst setzt sich eine Spirale aus weiteren Katastrophen und steigenden Schäden in Gang, die erst teuer und irgendwann unbezahlbar wird.“
EVP-Fraktionschef Weber fordert vom Steuerzahler europäische Flut-Finanzhilfe
Nach der verheerenden Flutkatastrophe vor allem im Westen Deutschlands wird der Ruf nach finanzieller Hilfe durch die Europäische Union lauter. „Europa muss zeigen, dass es in der Not da ist“, sagte der Fraktionschef der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Die vorhandenen Fonds zur Bewältigung von Naturkatastrophen müssten bei einer länderübergreifenden Flutkatastrophe dieses Ausmaßes aktiviert werden, sagte Weber, der auch CSU-Vize ist.
Ein Schwerpunkt solle auf dem Wiederaufbau der Infrastruktur liegen. Weber plädierte auch für ein längerfristig stärkeres Engagement der EU in solchen Katastrophenfällen: Die EU solle ihre Krisenfonds stärken und vor allem eine unbürokratische und schnelle Auszahlung möglich machen. „Es ist zu befürchten, dass Naturkatastrophen großen Ausmaßes künftig häufiger vorkommen werden. In der Krise bewährt sich europäische Hilfe“, sagte Weber.
Milliardenschäden an Schienen und Straßen wegen Hochwasser
Die Schäden durch die Hochwasser-Katastrophe liegen nach ersten Schätzungen des Bundesverkehrsministeriums bei fast zwei Milliarden Euro. Wie die „Bild“ berichtet, sollen allein im Schienennetz der Deutschen Bahn und an den Bahnhöfen Schäden von rund 1,3 Milliarden Euro entstanden sein. Es seien viele Strecken betroffen und teils bis zu 25 Kilometer Länge von den Wassermassen unterspült worden.
Doch auch auf den Straßen und Autobahnen gibt es große Zerstörungen. Auch dort gehen die Schäden den internen Erhebungen zufolge in den Bereich von mehreren hundert Millionen Euro. In den Hochwasser-Katastrophengebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen müssten Brücken, Gleise, Straßen und Mobilfunkmasten schnellstmöglich wieder instandgesetzt werden.
Es könnten aber 300 Behelfsbrücken des Bundes in unterschiedlicher Größe bei Bedarf schnell in den Krisenregionen aufgebaut werden. Auch die Bahn will eigene Behelfsbrücken einsetzen, damit die Züge wieder fahren können. Eigentlich müssten Länder und Städte „Leihgebühren“ für die Behelfsbrücken an den Bund bezahlen.
Darauf will das Bundesverkehrsministerium aber offenbar verzichten. „Wir haben jetzt unbürokratisch Sofortmaßnahmen ergriffen und werden weitere umsetzen. Wir müssen aufräumen, aufbauen und die gesamte Infrastruktur schnellstens für die Menschen zur Verfügung stellen“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer zu (CSU) „Bild“. (Mit Material von dts)