Kategorie: Nachrichten
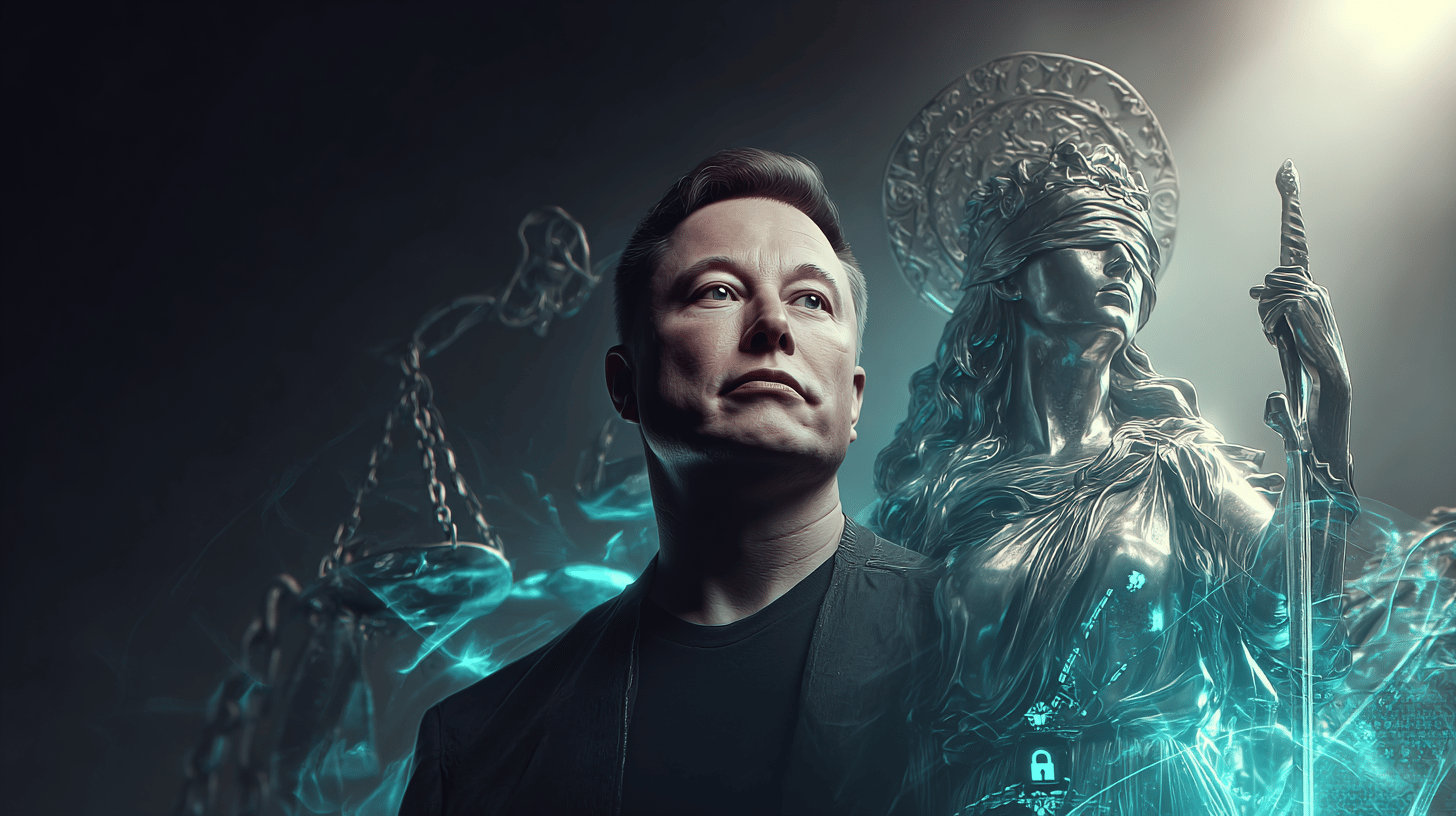
X schützt Nutzerdaten: Wie Elon Musks Plattform der Gesinnungsjustiz die Stirn bietet
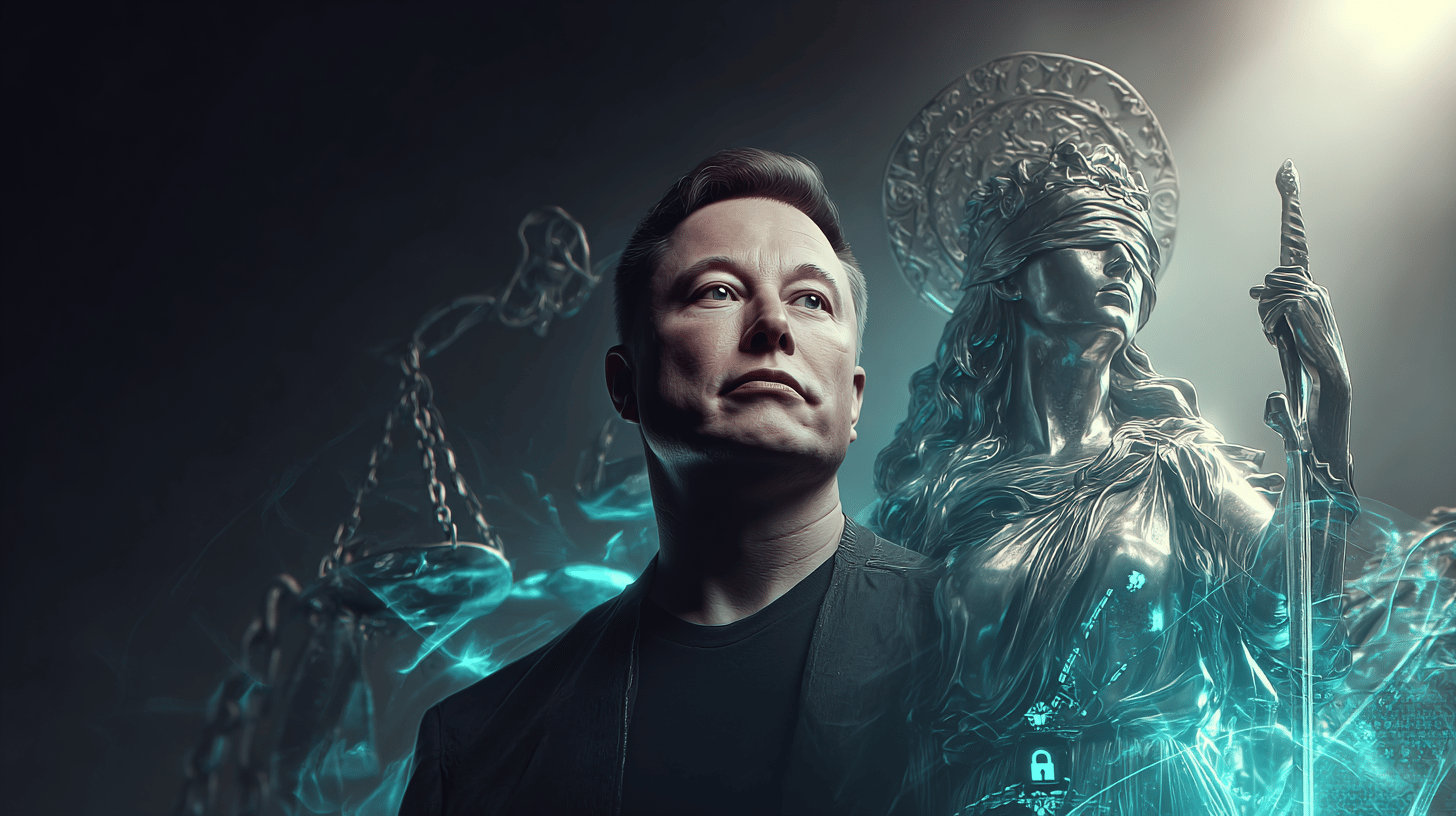
Während deutsche Behörden und Staatsanwälte immer häufiger versuchen, über Strafanzeigen wegen vermeintlicher “Beleidigungen” und “Hassrede” an persönliche Daten von Nutzern zu kommen, verweigert die Plattform X inzwischen konsequent die Kooperation. Ein Schlag ins Gesicht für die deutsche Gesinnungsjustiz.
Seit Elon Musk Twitter übernommen und zu “X” umfirmiert hat, positioniert sich das Unternehmen als Plattform für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Dies geht mittlerweile so weit, dass X die Herausgabe von Nutzerdaten wegen Bagatelldelikten wie “Beleidigung” konsequent ablehnt. Dem anhaltenden politisch motivierten Missbrauch des Strafrechts zur Meinungskontrolle wird zumindest dort die Stirn geboten.
Wie Rechtsanwalt Markus Haintz in einem Beitrag auf X darlegt, weiß beispielsweise die Staatsanwaltschaft Köln nicht, ob sie ein Rechtshilfeersuchen nach Irland oder in die Vereinigten Staaten schicken kann. Allerdings ist nicht klar, ob sich die Plattform bei Rechtshilfeersuchen ebenso derart “unkooperativ” zeigt, wenn Politiker involviert sind. Ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2020 zeigt aber ohnehin, dass polizeiliche Anfragen häufig sind – es braucht einen richterlichen Beschluss dafür, der auch eine tatsächliche juristische Grenzüberschreitung feststellt.
Wer heute noch glaubt, dass Polizei und Justiz im Netz nur gegen echte Straftäter vorgehen, verschließt die Augen vor der Realität. Denn es geht hierbei nicht um Gewalt gegen Menschen, sondern um Meinungsdelikte und persönliche Haltungen. Abweichende Meinungen werden als “Hass und Hetze” diffamiert und Menschen, die öffentlich Kritik am System üben, desavouiert. Elon Musk scheint zumindest diesbezüglich keine Scheu davor zu haben, sich mit den europäischen Wahrheitsministerien und Gesinnungswächtern anzulegen.
Einen sehr wichtigen Beitrag zum Thema Justizirrsinn liefert auch der deutsche Rechtsanwalt Konstantin Grubwinkler:

Unsichtbarer Einfluss: Wie 5G-Signale über biochemische Kanäle den Gehirnrhythmus verändern

Die gesundheitlichen Schäden durch 5G-Mobilfunkwerden immer öfter wissenschaftlich nachgewiesen. Eine Studie der Universität Zürich und Zusammenarbeit mit der ETH hat den schädlichen Einfluss auf das innere Funktionieren der Zellen nachgewiesen. In der Stille eines Zürcher Schlaflabors drifteten Freiwillige unter hochentwickelten EEG-Sensoren in den Schlaf. Ohne dass sie es bemerkten, interagierten unsichtbare Impulse von 5G-Hochfrequenz-Elektromagnetfeldern (RF-EMFs) […]
Der Beitrag Unsichtbarer Einfluss: Wie 5G-Signale über biochemische Kanäle den Gehirnrhythmus verändern erschien zuerst unter tkp.at.

Milei wirkt – Starkes Wirtschaftswachstum in Argentinien

Allen Unkenrufen zum Trotz haben die Reformen des libertären argentinischen Präsidenten, Javier Milei, eine wirtschaftliche Transformation zum Besseren bewirkt. Nicht nur, dass die Wirtschaft schneller wächst als jene Chinas, auch legt der Konsum der Privathaushalte deutlich zu. Milei wirkt.
Während Deutschland Dank der Überregulierung und der dystopischen Klimaideologie in der Rezession verharrt, ist Argentinien auf dem besten Weg, zur Boomnation dieses Jahrzehnts zu avancieren. Nach Jahrzehnten der peronistischen Misswirtschaft sorgen die umfassenden Reformen von Präsident Milei für eine wirtschaftliche Transformation, von der das ganze Land profitiert.
So wuchs das Bruttoinlandsprodukt des südamerikanischen Landes im ersten Quartal 2025 um satte 5,8 Prozent. Im letzten Quartal 2024 waren es saisonbereinigt noch plus 0,8 Prozent. Die Rezession zu Beginn des letzten Jahres ist damit Geschichte. Analysten der argentinischen Zentralbank gehen davon aus, dass die Wirtschaft des Landes dieses Jahr insgesamt um 5,2 Prozent wachsen wird.
Laut der OECD waren vor allem private Investitionen (das heißt, die Unternehmen sehen wieder Licht am Ende des Tunnels), der private Konsum und zunehmende Exporte Haupttreiber der Entwicklungen. Auch die Arbeitslosigkeit geht zurück und lag nur bei 6,4 Prozent. Die Reallöhne liegen mittlerweile wieder über dem Niveau von 2023, nachdem diese inflationsbedingt sanken. Da jedoch auch die Inflationsrate sinkt, wirkt sich dies positiv auf die Einkommen der Menschen aus. Ebenso verzeichnet das Land einen stabilen Haushalt mit leichten Überschüssen.
Mileis Kurs, welcher von den Anhängern staatsinterventionistischer Maßnahmen scharf kritisiert wurde, könnte zu einer beispiellosen Erfolgsstory avancieren. Doch dann werden auch andere Regierungen in Zugzwang geraten – und die Herausforderungen durch Parteien und Politiker, welche Mileis Erfolgsrezept übernehmen wollen, zunehmen.

Haaretz: Israelische Soldaten haben Befehl in Gaza auf Hilfesuchende zu schießen

Ärzte sagen, dass Hilfsgüterverteilungsstellen zu „Schlachthöfen“ geworden sind. Israelische Soldaten sagen im Gespräch mit Haaretz, sie hätten den Befehl erhalten, auf verzweifelte Palästinenser zu schießen, die versuchen, Verteilungsstellen für Hilfsgüter in Gaza zu erreichen. Über 550 Palästinenser wurden im letzten Monat bei dem Versuch, Hilfsgüter zu erhalten, getötet. „Israelische Soldaten in Gaza sagten Haaretz, dass […]
Der Beitrag Haaretz: Israelische Soldaten haben Befehl in Gaza auf Hilfesuchende zu schießen erschien zuerst unter tkp.at.

Der Mythos der Dekarbonisierung zerfällt, während die Kohlenwasserstoff-Nutzung zunimmt
![]()
Vijay Jayaraj
Man kann nicht die morgendlichen Schlagzeilen lesen oder durch den digitalen Äther scrollen, ohne von der feierlichen Verkündigung der globalen Medien überrollt zu werden: Die Gesellschaft löst sich langsam, aber sicher und unaufhaltsam von der tödlichen Umarmung der fossilen Brennstoffe.
Viele in der „aufgeklärten“ Fachwelt verzichten auf eine unabhängige Prüfung des Themas und wiederholen die Erklärung mit der energischen Überzeugung frisch bekehrter Anhänger. Heute haben wir es mit einem digitalen Amphitheater zu tun, das mit Hashtags und Halbwahrheiten überflutet ist, in dem die Wahrnehmung sich als Errungenschaft ausgibt und die Fehlinformation unter dem Banner der Unvermeidlichkeit marschiert.
Nehmen wir zum Beispiel China: Online-Posts über die unbestreitbare Abhängigkeit des Landes von der Kohle werden beschönigt oder falsch dargestellt. Die populäre Berichterstattung zeigt, dass Peking großes Interesse an „Netto-Null“ hat, was durch die Installation von Solar- und Windenergieanlagen in Rekordhöhe belegt wird. Das Auf und Ab des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und die Investitionen in „erneuerbare“ Technologien werden herausgepickt, um zu behaupten, dass die Nutzung von Kohlenwasserstoffen in China abnimmt.
Der Energiesektor in China kümmert sich jedoch wenig um diese Fantasien. Peking hat im Jahr 2024 mit dem Bau von 94,5 Gigawatt (GW) neuer Kohlekraftwerke begonnen und zusätzlich 3,3 GW ausgesetzter Projekte wieder aufgenommen. Dies ist der höchste Stand der Bauarbeiten in den letzten 10 Jahren!
Erst im Mai setzte China die weltweit größte Flotte fahrerloser Bergbau-Lkw ein, um den Betrieb zu beschleunigen, auch um die schwierigen Bedingungen des harten Winters in der Yimin-Kohlemine im Nordosten der Inneren Mongolei zu meistern.
Sowohl China als auch Indien investieren enorme Summen in Windturbinen und Solarzellen. Dennoch sollten wir diese eifrigen Aktivitäten nicht für einen Moment mit der eifrigen Ablehnung fossiler Brennstoffe verwechseln, die in einigen europäischen Ländern zu beobachten ist. Die asiatischen Länder verzichten nicht auf fossile Brennstoffe, sondern greifen nach jeder Energiequelle wie ein Hortungsunternehmen vor einer zu erwartenden Krise.
In einer Rede auf der Heartland International Conference im Jahr 2023 nannte ich dies die „Zwillingsstrategie“ – ein cleverer diplomatischer Pas de deux – bei dem Peking und Delhi fotogene „grüne“ Posen für die westliche Presse einnehmen, während sie im Stillen neue Kohlekraftwerke bauen und immer mehr Brennstoff dafür ausgraben und importieren.
Das Ergebnis? Beifall von Klimagipfeltreffen und Megawatt aus Schornsteinen – ein brillanter Balanceakt aus Tugendhaftigkeit und strategischem Realismus. Der Westen nennt es Heuchelei, China und Indien nennen es einen weiteren Tag im Büro.
Man muss das Narrativ der asiatischen Komplizenschaft bei der zunehmend ausfransenden „grünen“ Agenda verbreiten, um den Mythos einer dekarbonisierenden Welt am Leben zu erhalten, der für die meisten vernünftigen Menschen so glaubwürdig geworden ist wie der Osterhase.
Indiens Ziel, den Netto-Nullverbrauch zu erreichen, ist für das ferne Jahr 2070 angesetzt – 100 Jahre nach dem ersten Earth Day, dessen Einhaltung bis dahin ungefähr so relevant sein wird wie das Werfen von Jungfrauen in Vulkane. Dauerhafter wird das Engagement des Landes für wirtschaftliches Wachstum durch die Nutzung von Kohle, Erdöl und Erdgas sein – ein Weg, der in Zukunft die höchste Steigerungsrate bei der Energienachfrage haben wird.
Ähnlich verhält es sich in Dutzenden anderer Länder in Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika, wo neue Entdeckungen von Energiereserven und der Appetit auf wirtschaftlichen Fortschritt die Öl- und Gasindustrie boomen lassen.
Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 120 Öl- und Gasfunde gemacht, wobei bedeutende Bohrungen in Surinam, Zypern, Libyen und Südafrika erwartet werden. Etwa 85 % dieser Entdeckungen fanden in Offshore-Regionen statt, die größten davon in Kuwait und Namibia.
Rystad Energy prognostiziert, dass die Tiefseebohrungen im Jahr 2026 ein 12-Jahres-Hoch erreichen werden. Der britische Öl- und Gasmulti BP, einst das Aushängeschild der Klimabewegung, gibt seine Pläne zur Reduzierung der Produktion zugunsten von Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko auf. Das norwegische Unternehmen Equinor kündigte Anfang des Jahres an, dass „erneuerbare Energien“ in den Hintergrund treten würden, während die Offshore-Ölfelder des Landes wieder zum Leben erwachen.
Das Klimakommentariat, das bereits atemlos von seinen kreativen Verrenkungen zur Umgestaltung der Realität war, sieht sich nun durch Präsident Trumps Mittelkürzungen verunsichert, die dem klimaindustriellen Komplex den Hahn zugedreht haben.
In der Zwischenzeit bleibt das digitale Schlachtfeld ein Schauplatz für das anhaltende Tauziehen zwischen den Realitäten der Wirtschaft und der Physik und der phantasievollen Rhetorik über eine Energiewende. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe steigt dennoch weiter.
This commentary was first published at BizPac Review on June 20, 2025.
Vijay Jayaraj is a Science and Research Associate at the CO₂ Coalition, Fairfax, Virginia. He holds an M.S. in environmental sciences from the University of East Anglia and a postgraduate degree in energy management from Robert Gordon University, both in the U.K., and a bachelor’s in engineering from Anna University, India.
Link: https://wattsupwiththat.com/2025/06/22/decarbonization-myth-frays-as-hydrocarbon-use-grows/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Der Beitrag Der Mythos der Dekarbonisierung zerfällt, während die Kohlenwasserstoff-Nutzung zunimmt erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.
FREIMAURER-POLITIKER IN ÖSTERREICH: »Logenbruder, SA und NSDAP – Theodor Kery (SPÖ)«
Iran überlistet Israel: Kriegsplan vereitelt Überraschungsangriff! | Scott Ritter
Der jüngste Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hat die Welt in Atem gehalten. Doch die Ereignisse, die zu diesem fragilen Frieden führten, werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten. Scott Ritter, ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur und Experte für internationale Sicherheit, analysiert die Dynamiken des Konflikts und enthüllt die Hintergründe eines Scheinsiegs beider Seiten. Dieser Artikel fasst Ritters Einschätzung zusammen und beleuchtet, warum der Waffenstillstand auf tönernen Füßen steht.
Ein chaotischer Waffenstillstand: Politisches Theater statt echter Lösung
Nach einer Reihe von Angriffen, die mit einem überraschenden israelischen Schlag gegen den Iran begannen, gefolgt von einem iranischen Gegenschlag in den letzten Minuten vor Inkrafttreten des Waffenstillstands, haben beide Seiten einen vorläufigen Frieden geschlossen. Präsident Donald Trump verkündete den Waffenstillstand, doch Ritter sieht darin weniger einen strategischen Erfolg als ein politisches Manöver. „Beide Nationen waren verzweifelt auf einen Waffenstillstand angewiesen“, sagt er. „Doch keiner wurde besiegt, also müssen beide so tun, als hätten sie gesiegt.“
Israel glaubte, ein schneller „Enthauptungsschlag“ würde das iranische Regime destabilisieren. Doch dieser Plan scheiterte. Die israelische Raketenabwehr, unterstützt von den USA, konnte die iranischen Angriffe nicht vollständig abwehren. „Israel wurde schwer getroffen“, betont Ritter. „Die Schäden waren real und verheerend.“ Aufgrund einer Mediensperre Israels sind die genauen Ausmaße unklar, doch Ritter ist überzeugt, dass der Iran ebenso effektiv zuschlug wie Israel – wenn nicht effektiver. Beide Seiten waren politisch nicht in der Lage, den Konflikt fortzusetzen, was den Weg für den Waffenstillstand ebnete.
Trumps Dilemma: Gefangen in Israels Agenda
Ritter kritisiert Trumps Nahostpolitik scharf. Während Trump als Kandidat im September 2024 von einem möglichen Deal mit dem Iran sprach, um Sanktionen aufzuheben, sieht Ritter ihn in einer Falle: „Trump kann sich nicht von Israel lösen.“ Seine politische Basis bevorzuge nicht-militärische Lösungen, doch sein Beraterstab bestehe aus pro-israelischen Hardlinern, die eine Konfrontation mit dem Iran – notfalls mit Gewalt – anstreben. „Trump war zwischen Baum und Borke“, sagt Ritter. „Er musste handeln, um stark zu wirken, aber gleichzeitig einen großen Krieg vermeiden.“
Die US-Angriffe auf drei leere iranische Ziele seien „reines politisches Theater“ gewesen, ebenso wie der iranische Gegenschlag auf eine verlassene US-Basis. Beide Seiten hätten ihre Aktionen im Vorfeld angekündigt, um Opfer zu vermeiden. „Trump musste die ‚Wir haben den Iran bombardiert‘-Box abhaken, und der Iran die ‚Wir haben US-Einrichtungen angegriffen‘-Box“, erklärt Ritter. Diese choreografierten Aktionen hätten die Grundlage für einen Waffenstillstand geschaffen, der in den USA, Israel und dem Iran politisch akzeptabel war. „Wenn das Trumps Plan war, verdient er Anerkennung“, meint Ritter, bleibt aber skeptisch.
Irans nukleare Stärke: Ein Fehlschlag für Israel
Ein zentraler Punkt in Ritters Analyse ist die iranische Nuklearfähigkeit. Israel und die USA hofften, durch ihre Angriffe das iranische Atomprogramm zu zerschlagen. Doch Ritter widerspricht der Einschätzung, dass das Programm um zwei bis vier Jahre zurückgeworfen wurde. „Die angegriffenen Anlagen waren größtenteils leer“, sagt er. Der Iran habe sein 60-prozentig angereichertes Uran rechtzeitig verlagert und verfüge über intakte Zentrifugen, die in kurzer Zeit waffenfähiges Uran (90–92 %) produzieren könnten. „Die Idee, dass die Welt jetzt sicherer ist, ist eine Illusion“, warnt Ritter. „Der Iran ist heute gefährlicher als vor den Angriffen.“
Er betont, dass der Iran technisch in der Lage sei, innerhalb kurzer Zeit eine einfache Uranbombe mit einem „Gun-Design“ zu bauen, die auf eine Rakete montiert werden könnte. „Es ist reine Physik“, sagt er. „Die USA mussten nicht einmal die Bombe testen, die sie auf Japan warfen, weil sie wussten, dass sie funktioniert.“ Der Iran fehle nur der politische Wille, diesen Schritt zu gehen. Doch die jüngsten Angriffe könnten diesen Willen wecken, insbesondere da Russland inzwischen warnt, dass der Iran durch die westliche Politik zur Atomwaffenentwicklung gedrängt werden könnte.
Ballistische und strategische Fehlkalkulationen
Israel und die USA unterschätzten die iranische Schlagkraft. Der Iran verfüge weiterhin über eine beträchtliche Anzahl fortschrittlicher ballistischer Raketen, und seine Produktionskapazitäten könnten schnell wiederhergestellt werden. „Das Wissen ist der Schlüssel, und der Iran hat dieses Wissen“, sagt Ritter. Interessanterweise setzte der Iran keine Marschflugkörper ein, die schwerer abzufangen sind. Ritter spekuliert, dass diese für spätere Phasen eines Kriegsplans – etwa Angriffe auf Öl-Infrastruktur – zurückgehalten wurden. Ob Israels Angriffe die iranischen Arsenale geschwächt haben, bleibt unklar, da beide Seiten Informationen zurückhalten.
Die Dringlichkeit des Waffenstillstands erklärt Ritter mit der Verwundbarkeit beider Seiten. Israel habe begonnen, zivile Stadtteile in Teheran anzugreifen, was die iranische Regierung in Zugzwang brachte. „Die Regierung will ihr Volk schützen“, sagt Ritter. Er zieht Parallelen zum „Krieg der Städte“ 1988, als der Iran nach irakischen Raketenangriffen einen bitteren Frieden akzeptieren musste. Ähnlich habe der Iran nun einen Waffenstillstand gesucht, um weitere Schäden zu vermeiden – nicht aus Schwäche, sondern aus Verantwortung gegenüber der Bevölkerung.
Regimewechsel: Eine gefährliche Illusion
Ein wiederkehrendes Thema in Ritters Analyse ist die westliche Fixierung auf einen Regimewechsel im Iran. Israel und Teile der US-Regierung glaubten, die iranische Bevölkerung würde sich gegen ihre Regierung wenden. Doch Ritter sieht darin eine Fehleinschätzung: „Die Iraner mögen ihre Regierung kritisieren, aber wenn sie angegriffen werden, stehen sie zusammen.“ Präsident Raisi habe 2023 betont, dass der Iran trotz westlicher Destabilisierungsversuche gestärkt aus Unruhen hervorgegangen sei.
Ritter verweist auf historische Beispiele wie den Sturz von Saddam Hussein oder Bashar al-Assad, die westliche Akteure ermutigten, an einem Regimewechsel im Iran festzuhalten. Doch er warnt: „Die Bedingungen für einen Kollaps im Iran sind nicht gegeben.“ Dennoch bleibt die Idee lebendig, insbesondere in Israel, wo man laut Ritter aktiv Pläne verfolgt, iranische Führungsfiguren wie Ali Khamenei zu eliminieren. „Sie sind rachsüchtig“, sagt er. „Wenn sich die Gelegenheit bietet, werden sie zuschlagen.“
Ein Ausweg durch Diplomatie?
Ritter sieht eine Chance, den Konflikt zu entschärfen, aber nur durch sofortige diplomatische Bemühungen. „Die USA müssen schnell handeln, um einen Deal mit dem Iran zu schließen“, fordert er. Ein Kompromiss, der dem Iran begrenzte Urananreicherung (z. B. 3,75 %) erlaubt, könnte die Spannungen abbauen. Doch er misstraut der US-Politik, die den Iran mit falschen Verhandlungen hereingelegt habe. „Die Verhandlungen im April 2024 waren eine Falle“, sagt Ritter. „Die Entscheidung zum Angriff wurde bereits im März getroffen.“
Er plädiert dafür, andere Nationen wie Katar einzubeziehen, um eine nachhaltige Lösung zu finden. „Die USA können nicht allein die Führung übernehmen, da das Vertrauen in sie erschüttert ist“, sagt er. Ein Abkommen, das die iranische Nuklearbedrohung eindämmt, könnte die Regimewechsel-Fantasien beenden, wie es 1994 im Fall Iraks gelang, als Israel von einer Mordoperation gegen Saddam zu einer Politik der Eindämmung überging.
Fazit: Ein unsicherer Frieden
Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran ist ein fragiles Konstrukt, geprägt von politischem Theater, nationalem Stolz und ungelösten Spannungen. Scott Ritter warnt, dass weder Israel noch die USA ihre Ziele erreicht haben. Der Iran bleibt nuklear und militärisch stark, während Israel mit internen politischen Folgen der Kriegsschäden konfrontiert sein könnte. Ohne eine ernsthafte diplomatische Initiative droht eine erneute Eskalation. „Wir sind noch lange nicht aus dem Schneider“, schließt Ritter. „Führung ist gefragt – aber kann man den USA nach diesem Verrat noch vertrauen?“
Die Wahrheit über den Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran: Ein tiefer Einblick mit Colonel Douglas Macgregor
Der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran hat weltweit Aufmerksamkeit erregt. Doch was bedeutet er wirklich für die Region und die globale Politik? Colonel Douglas Macgregor, ein renommierter Experte für Geopolitik, teilt in einem aktuellen Interview seine Einschätzung zu den Hintergründen, Konsequenzen und der fragilen Natur dieses Waffenstillstands. Dieser Artikel beleuchtet die Kernpunkte seiner Analyse und bietet einen tiefen Einblick in die komplexe Lage im Nahen Osten.
Ein fragiler Waffenstillstand: Wer hat gewonnen?
Nach einem zwölftägigen Konflikt zwischen Israel und dem Iran wurde ein Waffenstillstand vereinbart, den beide Seiten als Sieg für sich reklamieren. Doch Macgregor stellt klar: Es gibt keinen klaren Sieger. „Es hängt davon ab, auf welcher Seite man steht“, sagt er. Aus iranischer Sicht habe das Land gezeigt, dass sein Waffenarsenal weit mächtiger ist, als viele vermuteten. Insbesondere die Fähigkeit, israelische Verteidigungssysteme mit einer Flut von Raketen zu überwältigen, habe Israel überrascht. Ein hochrangiger israelischer Politiker, Ben Gvir, gab sogar zu, dass die iranischen Kapazitäten unterschätzt wurden.
Israel hingegen feiert die Zerstörung angeblicher iranischer Ziele, doch Macgregor bezweifelt, dass diese Angriffe bedeutende Schäden verursacht haben. Laut seinen Quellen in Geheimdienstkreisen waren die angegriffenen Ziele weitgehend leer. „Es war ein optischer Erfolg“, so Macgregor, „aber strategisch irrelevant.“ Der Iran habe zudem die USA und Israel im Vorfeld über einen geplanten Gegenschlag informiert, der eine verlassene Luftbasis in Bahrain traf – ein symbolischer Akt ohne größere Konsequenzen.
Die Rolle der USA: Bedingungslose Unterstützung für Israel?
Ein zentrales Thema in Macgregors Analyse ist die bedingungslose Unterstützung der USA für Israel. „Es spielt keine Rolle, welche Partei an der Macht ist“, sagt er. Diese Politik verpflichte die USA, Israel finanziell und technologisch zu unterstützen, unabhängig von den Konsequenzen. Dies habe die USA in den aktuellen Konflikt hineingezogen, ohne dass eine klare Strategie erkennbar sei. „Ich sehe keine Strategie, nur impulsive Reaktionen“, kritisiert Macgregor die US-Politik unter Präsident Donald Trump. Er vergleicht Trumps Ansatz mit dem von Joe Biden und spricht sogar von einem „orangen McCain“, um die Kontinuität der US-Politik trotz scheinbar neuer Führung zu verdeutlichen.
Die Unterstützung Israels habe auch dazu geführt, dass die humanitäre Krise in Gaza weitgehend ignoriert wird. Macgregor schätzt, dass Hunderttausende in Gaza gestorben sind – sei es durch Gewalt oder Krankheiten – und sieht darin einen dauerhaften Konfliktkatalysator. „Solange die Gaza-Frage ungelöst bleibt, wird es keinen dauerhaften Frieden geben“, warnt er.
Irans gestärkte Position und die nukleare Frage
Entgegen westlicher Narrative glaubt Macgregor nicht, dass Irans nukleares Programm durch die jüngsten Angriffe geschwächt wurde. „Die Ziele waren leer“, betont er und verweist auf Informationen aus Geheimdienstkreisen. Iran habe seine Uranvorräte rechtzeitig verlagert und betone weiterhin, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen. Dennoch sieht Macgregor eine globale Konsequenz: „Jeder Staat, der die Möglichkeit hat, wird nun versuchen, Atomwaffen zu erwerben.“ Der Grund? Die Angst vor Interventionen durch die USA oder Israel.
Israel bleibt laut Macgregor die einzige Atommacht der Region mit etwa 90 Sprengköpfen. Diese nukleare Überlegenheit sei zentral für das „Groß-Israel-Projekt“, das eine regionale Dominanz anstrebt. Ein nuklearfreier Nahost, wie vom Iran gefordert, würde Israel zwingen, seine Waffen aufzugeben – ein Szenario, das für die israelische Führung undenkbar scheint.
Israels finanzielle und militärische Krise
Ein überraschender Punkt in Macgregors Analyse ist die prekäre Lage Israels. Laut Finanzminister Smotrich stehe das Land kurz vor einem wirtschaftlichen Kollaps. „Noch eine Woche, vielleicht zwei, dann implodiert die Wirtschaft“, zitiert Macgregor. Zudem habe Israel einen Großteil seiner Raketen verschossen, während die USA ebenfalls Nachschubprobleme hätten. „Wir bauen Raketen nicht schnell genug“, warnt er. Diese Schwäche könnte Israel dazu zwingen, den Waffenstillstand vorerst einzuhalten – doch Macgregor bleibt skeptisch: „Nichts hat sich grundlegend geändert.“
Netanyahus Strategie und die Frage des Regimewechsels
Macgregor ist überzeugt, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu den Konflikt nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober bewusst eskalierte. „Das war kein Zufall“, sagt er und verweist auf Warnungen, die Israel im Vorfeld ignoriert habe. Netanyahu nutze die Krise, um eine breitere regionale Auseinandersetzung zu rechtfertigen, gestützt durch die Kontrolle über US-Politiker. „Netanyahu hat mehr Einfluss im US-Kongress als Trump“, betont Macgregor.
Ein weiteres Ziel Israels sei der Regimewechsel im Iran. Macgregor erwähnt die Unterstützung für den Sohn des ehemaligen Schahs als potenziellen „Marionettenherrscher“ in Teheran. Doch er sieht wenig Aussicht auf Erfolg: „Die iranische Bevölkerung steht geeinter denn je hinter ihrer Regierung.“ Der Iran, als zivilisatorischer Staat mit tief verwurzelter Kultur, sei widerstandsfähiger, als viele im Westen annehmen.
Globale Perspektiven: Russland, China und die Ukraine
Macgregor weitet seinen Blick auf die globalen Implikationen. Russland und China beobachten die Entwicklungen im Nahen Osten mit Interesse, da sie ihre „One Belt, One Road“-Initiative vorantreiben wollen. Diese ziele darauf ab, Eurasien und Afrika wirtschaftlich zu integrieren – ein Projekt, das durch Instabilität im Nahen Osten gefährdet ist. „Russland ist der Schlüssel zur Stabilität in Zentralasien“, erklärt Macgregor, während China seine maritime Verwundbarkeit kompensieren will.
In Bezug auf die Ukraine sieht Macgregor Parallelen zu Israel. Präsident Selenskyj stehe vor einer ähnlichen strategischen Krise wie Netanyahu, jedoch in einer noch schlimmeren Lage. Mit schätzungsweise 1,5 Millionen toten ukrainischen Soldaten und einer systematischen russischen Offensive sei die Ukraine ein „Patient auf der Intensivstation“. Macgregor kritisiert Trumps Behauptung, den Krieg in 24 Stunden beenden zu können, als unrealistisch. Russland werde den Konflikt dominieren und die Ukraine wahrscheinlich in einen Rumpfstaat ohne Zugang zum Meer verwandeln.
Ausblick: Ein unsicherer Frieden
Macgregor schließt mit einer ernüchternden Prognose: Der Waffenstillstand ist nur eine Pause in einem größeren Konflikt. „Die strategischen Dynamiken sind in Bewegung und schwer zu stoppen“, sagt er. Israel werde weiterhin versuchen, seine regionale Dominanz zu sichern, während der Iran gestärkt aus dem Konflikt hervorgeht. Die USA, gefangen in ihrer bedingungslosen Unterstützung für Israel, riskieren eine weitere Eskalation ohne klare Strategie.
Für die Zukunft sieht Macgregor zwei Szenarien: Entweder bricht Frieden aus – was er für unwahrscheinlich hält – oder der Nahe Osten steht vor tiefgreifenden Veränderungen. „Die Landkarte der Region könnte sich grundlegend wandeln“, warnt er. Länder wie Syrien, der Irak oder Kuwait könnten ihre Grenzen neu definieren, während Großmächte wie Russland, China und die Türkei ihre Einflusssphären ausbauen.
Fazit
Colonel Douglas Macgregors Analyse zeigt, dass der Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran keine nachhaltige Lösung darstellt. Die Region bleibt ein Pulverfass, geprägt von wirtschaftlichen Krisen, nuklearen Ambitionen und geopolitischen Machtkämpfen. Ohne eine klare Strategie der USA und eine Lösung für die humanitäre Krise in Gaza droht der Konflikt weiter zu schwelen – mit potenziell verheerenden Folgen für den Nahen Osten und darüber hinaus.

ZDF: Ungarn schränkt Rechte von Lesbischen und Schwulen ein

Im ZDF-Heute-Journal am Samstag konnte man dem Moderator Christian Sievers, über den PI-NEWS erst kürzlich berichtete, die Genugtuung richtiggehend anmerken, dass nach dem Verbot der „Pride-Parade“ in Budapest „so viele wie nie zuvor“ gekommen waren. Das habt ihr nun davon, so sein linksparteiischer Unterton.
Neben dem Lob für die bunt Geschminkten gab es von ihm aber auch ernste und mahnende Worte an die ZDF-Zuschauer, es ging ja schließlich gegen Ungarn. Sievers bei Minute 7:30:
„Die ungarische Regierung schränkt seit Jahren die Rechte von Lesbischen, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen ein. Ungarns Polizei hatte die Pride-Parade, die genau für diese Rechte in Budapest stattfinden soll, verboten!“
Wie darf man sich das vorstellen? Dürfen sie nicht in die Schule? Dürfen sie bestimmte Berufe nicht ausüben? Nicht studieren? Nicht Nachrichtensprecher werden? Kein Schweinefleisch essen? Müssen sie ihre geschlechtliche Orientierung auf einem Fragebogen ankreuzen, bevor sie ein Café besuchen, und müssen draußen bleiben, wenn sie schwul sind?
Auf solche Fragen bleibt Sievers Antworten schuldig, vermutlich, weil es sie nicht gibt. Die Gründe für seine unbelegten Behauptungen sind andere. Ungarn ist klein genug, selbstbewusst genug und rechts genug, um sich als deutscher, linker Journalist an ihm abzuarbeiten, wenn man mal wieder einen Sündenbock braucht. „Zahlreiche Europaabgeordnete“ (Minute 9:51), unter ihnen die grüne Teletubby Terry Reintke, assistierten dabei, vermutlich ebenfalls auf Kosten der Steuerzahler. Reintke droht dem Land ganz offen (Minute 10:00) in der Propaganda-Sendung:
„Wir haben Mittel auf europäischer Ebene, Instrumente, um gegen Orban und diese Autokratisierung vorzugehen, Vertragsverletzungsverfahren, das Artikel 7-Verfahren [Verfahren, das es der EU ermöglicht, gegen Mitgliedstaaten vorzugehen, die schwerwiegend und anhaltend gegen die Grundwerte der EU verstoßen, Anmerkung PI-NEWS] und zum Beispiel Gelder einzufrieren. Ich sage ganz klar: Die Kommission muss da noch klarer werden und alles dafür tun, damit die Grundrechte in Ungarn nicht noch weiter eingeschränkt werden.“
Welche Grundrechte der LGBTQ+s werden denn eingeschränkt? Das sagt auch Reintke nicht. Niemand verbietet ihnen, im Schlafzimmer vor ihrem Partner in ihren bunten Kostümen zu posieren, sich am Hundehalsband durchs Bett führen oder sich auspeitschen zu lassen, solange beide oder alle drei ihren Spaß daran haben. Nur gibt es in einer zivilisierten Gesellschaft auch das Recht, sich nicht öffentlich ihre Fetische und ihren Gaga (Minute 9:31) ansehen und anhören zu müssen.
Und ein letztes Wort zur von Sievers hervorgehobenen Friedfertigkeit der Demonstranten. Sie blieben nicht trotz angeblicher Provokationen von Gegendemonstranten friedlich, sondern weil Budapest öffentliche Plätze mit Videotechnik überwacht, die mit Gesichtserkennung verbunden ist.
The post ZDF: Ungarn schränkt Rechte von Lesbischen und Schwulen ein appeared first on PI-NEWS.
Kontrafunk „Winters Woche“: Knast für Biodeutsche!
Während des Stadtspaziergangs für seinen satirischen Wochenrückblick trifft Achim Winter immer mehr Erwachte. Gerade in Sachen Klimakatastrophe winken die Leute zunehmend ab. Der Höllensommer ist kein Thema.
Auch versteht man mittlerweile, dass der Regierungswechsel in Sachen Meinungsfreiheit nicht das Geringste gebracht hat. Nach wie vor gilt: Ruhe ist die erste Bürgerpflicht, wenn es um die Vertuschung der wachsenden Probleme unseres Landes geht.
Wenn Sie also weitertwittern, sollten Sie sich wirklich einen guten Bademantel anschaffen und an Ihrem Nervenkostüm arbeiten. Ansonsten: Mund halten!
Kontrafunk „Sonntagsrunde“ mit Burkhard Müller-Ullrich: Bundeseinschüchterungstag
Die Publizisten Birgit Kelle, Wolfgang Koydl (Weltwoche) und Ralf Schuler (Nius) diskutieren mit Burkhard Müller-Ullrich über kopftuchtragende Lehrerinnen, Polizistinnen und Richterinnen; über universitäre Islamwochen mit experimenteller Sitzordnung; über die Vorspiegelung ministeriellen Machertums bei der Eindämmung des Migrantenstroms; über das 170-fache Razziatheater in Deutschland wegen Hass und Hetze im Internet sowie über das tragische Schicksal heutiger Politiker, ihre wahren Überzeugungen permanent verleugnen und ihre Wähler ständig belügen zu müssen.
The post Kontrafunk „Winters Woche“: Knast für Biodeutsche! appeared first on PI-NEWS.

Die einzigen echten Nazis der BRD-Geschichte gab es in den Altparteien
anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Die einzigen echten Nazis der BRD-Geschichte gab es in den Altparteien
Medien und Politik werden nicht müde, der AfD Nazi-Allüren zu unterstellen. Schaut man mal genauer hin, so stellt man fest, dass es Nationalsozialisten ausschließlich in den Altparteien gab. Vom SS-Sturmbannführer bis zum NSDAP-Mitglied findet sich in CDU, SPD und FDP alles, was unter Hitler Rang und Namen hatte.
von Klaus Rißler
Im Rahmen eines völlig irrationalen, so geschmacklosen wie auch wenig sachdienlichen, dafür allerdings umso mehr ideologisch missbrauchten Glaubenskampfes “gegen rechts“ (oder was auch immer sowohl von den Regierenden als auch den Systemparteien willkürlich als „rechts“ definiert wird) scheinen mittlerweile alle Dämme gebrochen zu sein. Selbst die sich mehr und mehr moralisch zerlegenden Kirchen sprangen trotz ihres fulminanten Versagens zwischen 1933 und 1945 (als der “Kampf gegen rechts” wahrlich angebracht gewesen wäre) in schleimig-anbiedernder Weise und vorauseilendem Gehorsam erneut auf den Propagandazug im Auftrag der Obrigkeit auf – und führen einen für sie finanziell offenbar durchaus lohnenden (?) Kampf gegen ein neues Feind- und Trugbild. Den Kirchenfunktionären seien deshalb nur die Worte aus Matthäus, 23. Kapitel, 13. Vers nahegelegt: „Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen! Ihr geht nicht hinein und die hineinwollen, lasst ihr nicht hineingehen.“
Überall dort, wo Menschen kritisches, mit den Vorgaben des „Wahrheitsministeriums“ nicht kongruentes Gedankengut vertreten, werden sie als Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, Umstürzler, Faschisten oder sogar Nazis diffamiert, welche nichts anderes im Schilde führen, als die angeblich noch existente demokratische Ordnung nicht nur in Frage zu stellen, sondern sie auch noch abschaffen zu wollen. Ist es aber nicht so, dass die Zahl der fortwährend mit regelrechten Denkverboten überzogenen Menschen bereits seit mindestens zehn Jahren stetig anwächst, weil sie den Eindruck gewonnen haben, dass sich der Faschismus in Form von angeblichen Demokratieförderungsmaßnahmen mehr und mehr den Weg in unsere Gesellschaft bahnt?
Lockeres Mundwerk
Mich wundert es immer wieder, wenn sich Angehörige von Parteien, die nach dem Kriege einer Vielzahl an überzeugten Nationalsozialisten eine neue politische Heimstatt im Ungeist eines fliegenden Wechsels von der absoluten Diktatur in eine freie Gesellschaft boten, heutzutage anmaßen, über Menschen ein vernichtendes Urteil zu fällen und ihnen eine rechtsextreme oder gar braune Gesinnung unterstellen, obwohl diese schon biographisch mit der unseligen NS-Vergangenheit nicht das Geringste zu tun haben. Nebenbei bemerkt bin ich ein Gegner der sogenannten Sippenhaft, was nichts anderes bedeutet, dass weder Söhne und Töchter, als auch Enkelinnen und Enkel von Kriegsverbrechern und überzeugten Nationalsozialisten nicht für das schreckliche Tun und Handeln ihrer Väter und Großväter moralisch in die Pflicht genommen werden dürfen.
Allerdings beobachtete ich aber auch immer wieder, dass gerade Nachfahren von überzeugten bis übelsten einstigen Nazis ein sehr lockeres Mundwerk gegenüber Personen führen, die nicht mit der Regierungspropaganda und deren Claqueuren aus dem medialen Umfeld übereinstimmen und deshalb dazu konträre Ansichten vertreten, die jedoch in keinster Weise dazu geeignet sind, deren Verfassungstreue in Frage zu stellen. Wer also selbst im Glashaus sitzt, sollte sich deshalb tunlichst unterstehen, mit Steinen zu werfen.
Leibhaftige Überzeugungstäter und Mitläufer
Verständlicherweise sitzen im aktuellen Berliner Reichstag keine persönlich durch eine braune Vergangenheit belastete Politiker mehr, da sie dazu an die 100 Jahre sein müsste – allenfalls jedoch deren Nachfahren. Nicht zuletzt deshalb finden sich in diesem Artikel fast nur Namen von Politikern der ehemaligen Bundesrepublik bis zum Jahre 1990. Während die meisten der aufgeführten Ex-Nationalsozialisten in Diensten des Parlaments der Bundesrepublik Deutschland jüngeren Lesern womöglich nur noch aus den Geschichtsbüchern geläufig sein könnten, dürften sie älteren Semestern noch gut bekannt sein. Allerdings werden hierbei aus einer Vielzahl an Bundestags- oder auch nur Landtagsabgeordneten vorzugsweise nur bekanntere Personen herausgegriffen während zur erschöpfenderen Suche auf diesen Link verwiesen sei
Echte, leibhaftige und früher überzeugte Nationalsozialisten gab es in allen damals im Parlament vertretenen politischen Gruppierungen wie CDU/CSU, SPD und FDP, allerdings mit einer klaren Dominanz bei CDU/CSU und FDP. Beginnen wir deshalb mit den in CDU/CSU heimisch gewordenen NSDAP-Mitgliedern, gefolgt von FDP und SPD.
Vormalige Nazis in CDU/CSU
Kurt Georg Kiesinger (1904 – 1988), Bundeskanzler von 1966-1969: Ob er ein absoluter Top-Nazi war, dürfte sich heute nicht mehr eindeutig belegen lassen. Allerdings bekleidete er einen hohen Posten im Außenministerium bei Reichsaußenminister Joachim Ribbentrop und war nicht unbedingt als das NS-System ablehnend bekannt. Dennoch schaffte er es, im Entnazifizierungs-Verfahren als Mitläufer eingestuft und im Jahre 1948 vollständig entlastet zu werden. In diesem Zusammenhang mögen sich die Älteren unter uns sicherlich noch an die ihm von Beate Klarsfeld beim Berliner CDU-Bundesparteitag 1968 verpasste Ohrfeige erinnern.
Hans Filbinger (1913 – 2007), Ministerpräsident von Baden-Württemberg 1966-1978: Er wurde im Rahmen der sogenannten Filbinger Affäre vom Februar 1978 von seiner NS-Vergangenheit eingeholt. Als Marinerichter war er an vier Todesurteilen beteiligt, beantragte und bestätigte zumindest dasjenige gegen den Matrosen Walter Gröger (1922 – 1945). Als Folge dieses Skandals wurde er gezwungen, am 7. August 1978 von seinem Amt zurückzutreten. Dem selbsternannten „Widerstandskämpfer“ kam offenbar jedwedes Unrechtbewusstsein abhanden, wie aus seinen Worten „Was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein“ ersichtlich wurde
Theodor Oberländer (1905 – 1998), Bundesminister für die Angelegenheiten der Vertriebenen 1953 – 1960: Er trat am 1. Mai 1933 Eintritt in die NSDAP ein, war dort vom 1. Juli 1933 bis zum 1. Juni 1937 in leitenden Positionen (Gauamtsleiter des Gau-Grenzlandamtes, Mitglied der NS-Gauleitung von Ostpreußen, 1936 Gastdozent an
der NS-Ordensburg Vogelsang) tätig. In einem Prozess wurde er vom Obersten Gericht der DDR in Abwesenheit wegen Erschießung von mehreren tausend Juden und Polen in Lemberg zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt.
Hans Globke (1898 – 1973), Chef des Bundeskanzleramtes 1953 – 1963: Er war beteiligt an der Ausarbeitung einer Reihe von Gesetzen, die auf die Gleichschaltung der Rechtsordnung Preußens mit dem Reich abzielten, Beteiligung an Maßnahmen zur Ausgrenzung und Verfolgung von Juden (Nürnberger Gesetze von 1935).
Carl Carstens (1914 – 1992), Bundespräsident von 1979 – 1984: Trat am 10. November 1937 in die NSDAP ein; da seine Mitgliedschaft während der Dauer des Kriegsdienstes ruhte, bestritt er diese Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens und wurde als “Mitläufer” eingestuft.
Herman Höcherl (1912 – 1989), Bundesminister 1961 – 1969 (verschiedene Ressorts): Von 1931 bis 1932 Mitglied der NSDAP, trat zum 1. Mai 1935 der Partei erneut bei.
Alfons Goppel (1905 – 1991), Ministerpräsident von Bayern 1962 – 1978: Ab November 1933 Mitglied der SA und ab 1. Mai 1937 Mitglied der NSDAP. Er war 1979 – 1984 auch Mitglied des Europäischen Parlaments.
Helmut Lemke (1907 – 1990), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein 1963 bis 1971: Trat am 1. April 1932 der NSDAP bei und bezog mit seinem Plädoyer für das „Führerprinzip“ deutlich Position für den NS-Staat; war als Bürgermeister von Eckernförde an der Verhaftung zahlreicher Sozialdemokraten und Kommunisten in Eckernförde beteiligt.
Gebhard Müller, Ministerpräsident von Baden-Württemberg 1953 – 1958: War Mitglied des Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) und der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV), sowie förderndes Mitglied der SS.
Hanns-Martin Schleyer (1915 – 1977), Wirtschaftsfunktionär: War Mitglied des Nationalsozialistischen Studentenbundes (NSDStB), SS-Offizier im Rang eines SS-Untersturmführer. Am 27. Januar 1944 wurde er zum SS-Führer beim Reichssicherheitshauptamt ernannt und war damit in der Zentrale des Völkermordes angekommen. Das Entnazifizierungsverfahren des hochgradigen Nazis Schleyer endete unbegreiflicherweise mit der Einstufung als Minderbelasteter, wogegen er Einspruch einlegte und seit Dezember 1948 nur noch als Mitläufer galt.
Vormalige Nazis in der FDP
Ernst Achenbach (1909 – 1991), Parlamentarier im nordrhein-westfälischen Landtag und im Europäschen Parlament 1950 – 1977: am 1. Dezember 1937 Aufnahme in die NSDAP, während der deutschen Besatzung in Frankreich als Leiter der politischen Abteilung des deutschen Botschafters mit „Judenangelegenheiten“ befasst und dabei auch für Verschleppung und Tod französischer Juden und folglich der Beihilfe zu mehrtausendfachem Mord verantwortlich, wie zum Beispiel durch die von ihm angeordnete Deportation von 2000 französischen Juden nach Auschwitz im Anschluss ein eine Aktion der Résistance vom Februar 1943. Dieser hochkarätige Nazi war sogar auch noch als Rechtsvertreter in Entnazifizierungsverfahren tätig und engagierte sich in den 50er Jahren für eine Generalamnestie für NS-Täter. Außerdem beeinflusste er das Zustandekommen des sogenannten Straffreiheitsgesetzes von 1954 für NS-Täter.
Ewald Bucher (1904 – 1991), Bundesminister für Wohnungswesen und Städtebau 1965 – 1966: Er war von 1931 – 1933 Mitglied des NS-Schülerbundes, ausgezeichnet mit dem Goldenen Abzeichen der Hitler-Jugend, danach Mitglied in NSDAP und SA, von 1953 – 1969 MdB, 1962 – 1965 Bundesminister der Justiz, 1965 – 1966 Bundesminister für Wohnungswesen und Städtebau, 1984 wechselte er über in die CDU.
Siegfried Zoglmann (1913 – 2007): u.a. Bundestagsabgeordneter 1957 – 1976: War Sekretär des Jugendverbandes des sudetendeutschen Ablegers der NSDAP, der DNSAP, 1934 Eintritt in die NSDAP, 1939 Chef der Berliner Schriftleitung der Reichszeitung der Hitler-Jugend „Die HJ”, 1943 freiwilliger Eintritt in die Waffen-SS und Soldat in einer Sturmgeschützabteilung der Leibstandarte SS Adolf Hitler an der Ostfront.
Walter Scheel (1919 – 2016), vierter Bundespräsident 1974 – 1979: Seit 1941 NSDAP-Mitglied, war 1962 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit unter Adenauer, 1968 Bundesvorsitzender der FDP als Nachfolger von Erich Mende, 1969 Vizekanzler und Minister des Äußeren unter Willy Brandt.
Willy Weyer (1917 – 1987): Landesminister in Nordrhein-Westfalen in wechselnden Kabinetten 1954 – 1975: Wurde 1937 Mitglied der NSDAP.
Vormalige Nazis in der SPD
Karl Schiller (1911 – 1994), Bundeswirtschaftsminister 1966 – 1972: War von Juni 1933 – 1938 Mitglied der SA, 1. Mai 1937 Eintritt in die NSDAP und politischer Leiter der Kieler Ortsgruppe „Klaus Groth“, ab Juni 1933 – 1935 Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Studentenbund, ab 1934 im NS-Rechtswahrerbund und ab 4. Mai 1939 im NS-Dozentenbund.
Horst Ehmke (1927 – 2017), Bundesminister 1969 – 1974 (verschiedene Ressorts): Wurde am 20. April 1944 in die NSDAP aufgenommen, nach seiner „Enttarnung“ im Jahre 2007 wollte er angeblich nichts davon gewusst haben.
Erhard Eppler (1926 – 2019), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit 1968 – 1974: Am 6. September 1943 im Alter von 16 Jahren Aufnahme in die NSDAP (Eppler war wenigstens so ehrlich und sagte später, dass dies das damals eben auch akzeptiert habe).
Jakob “Jockel” Fuchs (1919 – 2002), populärer Oberbürgermeister der Stadt Mainz 1965 – 1987: Wurde am 1. September 1938 in die NSDAP aufgenommen, war 1938 Volontär beim nationalsozialistischen “Nationalblatt” in Bad Kreuznach.
Mit welchem moralischen Recht urteilen die Altparteien?
Diese vorstehende Auflistung ist nur ein winziger Ausschnitt an Persönlichkeiten, die die Bundesrepublik geprägt und mit aufgebaut haben und dennoch mehr oder minder in eine Diktatur verstrickt waren und in ihr gewirkt haben. Wenn auch eine Reihe der behandelten Politiker vielleicht nicht unbedingt überzeugte und hochkarätige Nazis, vielleicht auch nur opportunistische Mitläufer waren, so haben sie durch ihre Mitgliedschaft in der NSDAP mit dazu beigetragen, dass sich eine schreckliche Diktatur mit vielen Millionen an Opfern über mehr als 12 Jahre halten konnte. Und Fakt bleibt, dass diese NS-Vergangenheit ihren späteren Karrieren in just den Parteien keinen Abbruch tat, die sich heute als “Unsere-Demokratie-Retter” aufspielen. Während die erst 2013 gegründete AfD tatsächlich als einzige Partei keine Alt-Nazis in ihren Reihen hatte, trifft oder traf dies auf alle anderen Parteien (selbst die Grünen und die Linke) eben zu.
Urteilen Sie, verehrte Leserinnen und Leser, daher selbst, ob Vertreter ausgerechnet dieser Parteien heute das moralische Recht für sich in Anspruch nehmen dürfen, die AfD (als die fast ein Viertel der Deutschen repräsentierende Opposition) in die Nähe des Nationalsozialismus zu rücken – und Menschen, die allein schon der Geburt wegen mit dem NS-System nichts zu tun haben konnten, mit dem leider immer mehr inflationär gebräuchlichen Begriff „Nazi“ zu stigmatisieren…
Der Beitrag Die einzigen echten Nazis der BRD-Geschichte gab es in den Altparteien ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

Schiffe in der Straße von Hormus senden rätselhafte Signale
anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Schiffe in der Straße von Hormus senden rätselhafte Signale
Nach der Eskalation des iranisch-israelischen Konflikts häufen sich in der Straße von Hormus merkwürdige Vorfälle: Tanker geben Falschinformationen wie “russisches Öl” oder “gehört China” über ihre Herkunft ab, um Angriffe zu vermeiden.
Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Daten des Analyseunternehmens für maritime Logistik “Windward” sowie das entsprechende Monitoring berichtet, versenden die Schiffe in der Straße von Hormus seit der Eskalation im Nahen Osten Nachrichten über ihre Zugehörigkeit. Diese Signale seien ungewöhnlich und sollen offenbar Angriffe aus Iran verhindern, heißt es in der Meldung. Experten zufolge haben 55 Schiffe zwischen dem 12. und 24. Juni bereits 101 “atypische Meldungen” über ihre Zugehörigkeit gesendet. Dazu gehörten Angaben wie “russisches Öl” oder “gehört zu China”. Das Phänomen, das bisher nur im Roten Meer zu beobachten war, wo die Huthi operierten, sei nun zum ersten Mal im Persischen Golf beobachtet worden.
Wie der CEO von Windward, Ami Daniel, in einem Gespräch mit Reuters erklärte, habe er “so etwas im Golf noch nie gesehen”. Experten sehen den Grund dafür in den anhaltenden Risiken nach dem brüchigen Waffenstillstand zwischen Israel und Iran. Demnach könnten Reeder befürchten, dass Schiffe, die mit den USA, Großbritannien oder Israel in Verbindung stehen, für Iran nach wie vor als Ziele gelten. Ein Hinweis auf die Zugehörigkeit zu Russland oder China werde hingegen als gute Verteidigung und Absicherung angesehen.
Laut Reuters meldete die Besatzung des unter panamaischer Flagge fahrenden Containerschiffs Yuan Xiang Fa Zhan, das nach Pakistan unterwegs war, am 26. Juni bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormus, dass das Schiff chinesisch sei. Der Supertanker Yuan Yang Hu, der Rohöl von Saudi-Arabien nach China transportierte, sendete eine ähnliche Nachricht. Sobald das Schiff die Straße von Hormus jedoch verlassen hatte, änderte sich das Signal. Möglicherweise handelte es sich also um eine falsche Meldung, die nur der Verteidigung diente. Das unter der Flagge Singapurs fahrende Containerschiff Kota Cabar signalisierte bei der Durchfahrt durch das Rote Meer, dass “das Schiff nicht in Verbindung mit Israel steht”, so Reuters weiter.
Experten zufolge seien solche Signale deshalb ungewöhnlich, weil Tanker normalerweise nur Informationen über den Bestimmungsort oder Nachrichten zur Beförderung der Fracht übermitteln. In einigen Fällen können die Meldungen darauf hinweisen, dass bewaffnete Sicherheitsleute an Bord sind, um Piraten und andere mögliche Überfälle abzuwehren.
Der Beitrag Schiffe in der Straße von Hormus senden rätselhafte Signale ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

