Kategorie: Nachrichten
Ruhrkent ist überall
Von W. SCHMITT | Der 2014 erschienene Roman „Ruhrkent“ („Ruhrstadt“) spielt in einer zukünftigen islamischen Autonomieregion im Ruhrgebiet. Auch elf Jahre nach der Erstauflage ist das Buch ungebrochen aktuell: Der staatliche Fahrplan zur Islamisierung Deutschlands wird bekanntlich präzise eingehalten. Dieser Plan war vor elf Jahren genauso offensichtlich wie heute. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich die Zustände in Deutschland in den nächsten zehn oder 20 Jahren vorzustellen, sofern sich politisch nichts grundsätzlich ändert: Noch mehr Islam, noch mehr Moscheen, noch mehr Arabisch und noch weniger Deutsch, noch weniger innere Sicherheit, noch weniger Weihnachtsmärkte – die indigene deutsche Bevölkerung wird Schritt für Schritt in die Enge getrieben.
Diese ausweglose Enge bestimmt auch das Schlusskapitel des Buches. „Ruhrkent“ ist elf Jahre nach der Erstauflage ein weiterhin hochaktuelles Szenario unserer eigenen Zukunft.
Was sich der unbekannte Autor „C. M.“ im Jahr 2014 aber wohl nicht hat vorstellen können, ist die extreme Radikalisierung und Industrialisierung der staatlichen Umvolkungspolitik seit 2015. Diese Radikalisierung ist zum einen geprägt durch die schiere Masse der importierten Mohammedaner, zum anderen deren flächendeckende Ansiedlung. Es wird seit 2015 deutlich weniger dem Zufall oder der freien Wahl überlassen, wo sich die Araber und Afghanen am liebsten niederlassen. Denn der Staat sorgt durch seinen „Königsteiner Schlüssel“ mehr denn je für deren gleichmäßige Verteilung in ganz Deutschland.
Für diese gleichmäßige Verteilung gibt es zwei wesentliche Gründe: Zum einen soll der indigenen deutschen Bevölkerung jede Ausweich- und Rückzugsmöglichkeit genommen werden. Eine „Flucht nach Ostdeutschland“ soll es nicht geben, Reservate, in denen indigene Deutsche allein nach ihren Vorstellungen leben können – wie dies im Fall der nordamerikanischen Indianer praktiziert wird –, passen nicht in die Konzeption der totalen „Bunten Republik Deutschland“.
Zum anderen soll genau die in „Ruhrkent“ beschriebene Ballung von Mohammedanern in bestimmten Gebieten Deutschlands verhindert werden. Ohne die landesweite Verteilung der Millionen von allein seit 2015 aus dem Nahen Osten nach Deutschland einmarschierten Personen wäre das Ruhrgebiet schon heute ein rein islamisches Gebiet. Hätten wir aber bereits heute in NRW ein rein islamisches Territorium, wären die Rufe dort nach einem „Kalifat“ oder sonstigen autonom-islamischen Regierungsformen noch um etliches lauter. Genau diese Lautstärke jedoch soll verhindert werden, um die indigen-deutsche Bevölkerung nicht zu wecken: Die totale Umvolkung unserer Heimat kann nur gelingen, wenn die indigene Bevölkerung selbst im unmittelbaren Angesicht dieses großen politischen Verbrechens weiter künstlich beruhigt im Betäubungsschlaf verbleibt und daher den Mund hält.
Das Einrollen der deutschen Fahne und Hissen der neuen Fahne eines islamischen Autonomiegebiets vor dem Duisburger Rathaus, wie im Kapitel „Die Posaunenklänge“ beschrieben, bleibt dennoch ein weiterhin denkbares Szenario. Die seit 2015 verstärkt landesweit vollzogene Umvolkung begünstigt zwar eine flächendeckende Islamisierung Gesamtdeutschlands, sie führt aber nicht zu einer Vereinheitlichung der Bevölkerungsstrukturen: Selbst mit Hunderten von Luftbrücken aus Kabul lassen sich nicht so viele Afghanen in Sachsen ansiedeln wie bereits Türken und Araber in NRW leben. Das Ruhrgebiet – und andere seit Jahrzehnten massiv umgevolkte Regionen Westdeutschlands – bleibt also trotz der nunmehr auf geographische Breitenwirkung ausgerichteten staatlichen Siedlungsstrategie weiterhin eine potenzielle Keimzelle autonomer islamischer Territorialbestrebungen.
Anders als zum Erscheinungszeitpunkt von „Ruhrkent“ im Jahr 2014 stehen heute also zwei unterschiedliche Szenarien im Raum: Die islamische Landnahme Deutschlands erfolgt entweder weiterhin schrittweise, wie im Roman beschrieben, sie wird daher auch zu einer schrittweisen Übernahme einzelner Territorien führen, beginnend mit einigen besonders stark umgevolkten Kernregionen, denen sich nach und nach andere Gebiete anschließen werden – das ist jedenfalls das Szenario in „Ruhrkent“.
Oder aber die Landnahme wird nicht dezentral, sondern zentral von Berlin aus vollzogen. Denkbar wären hier beispielsweise künftige Koalitionsregierungen auf Bundesebene unter Einbeziehung neuer islamischer Parteien. Fünf Prozent Wählerstimmen würden einer Art deutscher Hamas bereits reichen, um an die Hebel der Macht zu gelangen. Die CDU wird zweifellos auch solchen Leuten ihre schmutzigen Hände reichen; Hauptsache, sie darf Kanzler spielen. Die Einführung des Arabischen als offizieller Landessprache, die Umbenennung von Städten, ein wachsender gesellschaftlicher Druck auch auf indigen-deutsche Frauen, Kopftücher umzulegen und keine Stöckelschuhe zu tragen, noch mehr Überwachung und Einschränkung der Redefreiheit – all diese in „Ruhrkent“ beschriebenen Szenarien voranschreitender islamischer Landnahme wären dann nicht nur auf einige wenige Gebiete beschränkt, sondern wir hätten solche Entwicklungen in allen Teilen Deutschlands gleichermaßen.
Wenn wir es also nicht schaffen, das Unrecht der staatlichen Umvolkungspolitik ein für allemal zu beenden, werden wir wie der Held des Romans zu ohnmächtigen Zeitzeugen unseres eigenen Schicksals werden. Wir werden dann entweder das eine oder das andere dieser beiden Szenarien am eigenen Leibe erfahren: Entweder „Ruhrkent“ bleibt eine tatsächlich nur auf massiv umgevolkte westdeutsche Gebiete wie das Ruhrgebiet bezogene Erzählung, und man kann sich vor den Schrecken dieses Buches auch in Zukunft noch in Dresden verstecken. Oder es heißt eines nicht mehr fernen Tages: „Ruhrkent“ ist überall.
The post Ruhrkent ist überall appeared first on PI-NEWS.

Treibstoffschmuggel: Iran setzt erneut Tanker fest

Der Iran überwacht den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus genau. Erneut wurde ein Öltanker festgesetzt, weil dieser Treibstoff geschmuggelt habe. Dies ist auch eine Machtdemonstration Teherans.
Mit der faktisch durchsetzbaren totalen Kontrolle über die Straße von Hormus, welche den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet, kann Teheran einen erheblichen Teil des globalen Ölhandels überwachen und theoretisch auch blockieren. Immer wieder gibt es seitens der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) Machtdemonstrationen. So auch kürzlich wieder, als ein unter der Flagge des südafrikanischen Staates Eswatini fahrender Öltanker mit “geschmuggeltem Treibstoff” festgesetzt wurde.
“Ein Schiff mit 350.000 Litern geschmuggeltem Treibstoff, das unter der Flagge von Eswatini fuhr, wurde beschlagnahmt und nach Buschehr gebracht”, sagte ein IRGC-Mitglied den staatlichen Medien. “An Bord befinden sich 13 Besatzungsmitglieder, alle aus einem Nachbarland und Indien.” Das beschlagnahmte Öl dürfte zur Auffüllung der IRGC-Kassen dienen.
Als Reaktion darauf veröffentlichte Eswatini eine Erklärung, in der jegliche Beteiligung des Landes an dem Vorfall bestritten wurde. Es hieß, derzeit seien keine Schiffe berechtigt, die Flagge Eswatinis zu führen. “Das Königreich Eswatini hat keinerlei Verbindung zu dem angeblich im Iran festgesetzten Schiff und wir weisen jeglichen Versuch, unser Land mit maritimer Kriminalität in Verbindung zu bringen, aufs Schärfste zurück”, hieß es in der Erklärung.
Dieser Vorfall deutet darauf hin, dass Teheran angesichts der mittlerweile wieder verschärften Sanktionen nun wieder den Druck auf die Schifffahrt durch die geostrategisch wichtige Meerenge erhöht. Eine Machtdemonstration, wonach es der Iran ist, welcher den maritimen Verkehr durch die Straße von Hormus kontrolliert.
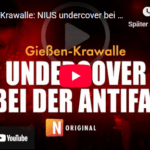
Gießen-Krawalle: Undercover bei der Antifa (Video)
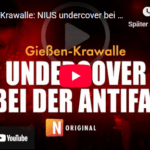 Regelmäßig kommt es bei Parteitagen der AfD zu gewaltsamen Ausschreitungen durch die sogenannte Antifa. So auch am vergangenen Wochenende in Gießen. 25.000 linke Demonstranten setzten die hessische Stadt lahm und blockierten Autobahnen, Brücken und Zufahrten – mit dem Ziel, der AfD und ihren Delegierten die Durchführung des Parteitags so schwer wie möglich zu machen. NIUS-Reporter […]
Regelmäßig kommt es bei Parteitagen der AfD zu gewaltsamen Ausschreitungen durch die sogenannte Antifa. So auch am vergangenen Wochenende in Gießen. 25.000 linke Demonstranten setzten die hessische Stadt lahm und blockierten Autobahnen, Brücken und Zufahrten – mit dem Ziel, der AfD und ihren Delegierten die Durchführung des Parteitags so schwer wie möglich zu machen. NIUS-Reporter […]
Der Beitrag Gießen-Krawalle: Undercover bei der Antifa (Video) erschien zuerst auf Philosophia Perennis.

48-Milliarden-Schock: Wie korrupt ist das Selenskyj-Regime tatsächlich?

Warme Geldregen aus dem Ausland verleiten dazu, zuzugreifen. Insbesondere dann, wenn das Geld auch noch in eines der korruptesten Länder der Welt fließt. Nun wird wohl der Verbleib von 48 Milliarden Dollar an Ukraine-Hilfsgeldern untersucht. Hat auch Präsident Selenskyj zugegriffen?
Manchmal hat man das Gefühl, die Ukraine sei weniger ein Staat als ein gigantisches Staubsaugerrohr, das in unheimlicher Präzision westliche Steuergelder einsaugt und irgendwo zwischen Kiew, Dubai und Tallinn wieder ausspuckt. Nun folgt also die nächste Bombe: Laut Ex-CIA-Analyst Larry Johnson untersucht das Pentagon höchstpersönlich, wo stolze 48 Milliarden Dollar an “Ukraine-Hilfen” abgeblieben sind. Die Spur soll demnach direkt auf private Konten von Präsident Wolodymyr Selenskyj führen. Natürlich ganz zufällig, wie immer. Und wieder einmal fragt man sich: Wie viel Geld kann man eigentlich in dubiose Kanäle umleiten, bevor jemand im Westen der politischen Klasse peinlich berührt den Blick senkt?
Johnson berichtet im Interview auf dem YouTube-Kanal „Judging Freedom“, dass große Teile der verschwundenen Milliarden über Estland liefen. Das ist praktisch, denn dort sitzt nicht nur ein NATO-treues Politestablishment, sondern von dort kommt auch die an schwerwiegender Russophobie leidende Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte. Ausgerechnet jene Dame, die seit Jahren wie eine politisch aufgezogene Blechdose für “Krieg bis zum Sieg” trommelt. Nun wissen wir vielleicht auch warum: Wenn man mitten im Zahlungsfluss steht, hat man ein großes Interesse daran, dass der Krieg weiterläuft. Man möchte ja schließlich nicht, dass jemand plötzlich die Bücher öffnet.
Auch die von der EU sanktionierte Alina Lipp (weshalb wir ihren Tweet nicht verlinken dürfen) mischt sich ein und stellt auf X die einzig relevante Frage: “Wo sind die 48 Milliarden Dollar geblieben?” Eine Frage, die in jedem halbwegs funktionierenden Rechtsstaat Panik auslösen würde. In Europa, bei den Mainstreamredaktionen, hingegen löst sie nur ein gelangweiltes Gähnen aus. Und das gerade dort, wo man sich sonst für jede ukrainische Sack-Reis-Meldung interessiert. Sobald die Spur aber Richtung EU-Eliten führt, will kaum jemand mehr recherchieren.
Johnson macht jedenfalls kein Geheimnis daraus, dass Washington langsam der Geduldsfaden reißt. Wenn Selenskyj nicht spurt, so sein Hinweis zwischen den Zeilen, dann könne es gut sein, dass der “Held im grünen Shirt” bald nicht mehr lange im Amt bleibt. Immerhin kennt man in den USA die Mechanik von Marionetten: Man hängt sie auf, man lässt sie tanzen – und man nimmt sie ab, wenn das Theater vorbei ist.
Die Vorwürfe kommen nicht aus dem Nichts. Allein die Enthüllungen der vergangenen Wochen könnten die Vorlage für ein Drehbuch eines osteuropäischen Mafia-Blockbusters sein, allerdings ohne Hollywood-Romantik. Das Nationale Antikorruptionsbüro (NABU) und die Sonderstaatsanwaltschaft SAP – Institutionen, die es ohne US-Druck gar nicht gäbe – haben ein Netzwerk an Beamten, Ministern, Geschäftsleuten und Parteifreunden enttarnt, das im Energiesektor 100 Millionen Dollar abzweigte. Das sind freilich Peanuts im Vergleich zu den 48 Milliarden, aber immerhin ein Wink mit dem Zaunpfahl.
Die Namen, die auftauchen, haben alle mit dem ukrainischen Präsidenten zu tun: Tymur Minditsch, Geschäftsmann und Selenskyj-Vertrauter, zugleich Miteigentümer von Kvartal 95 – der Produktionsfirma, die Selenskyj einst berühmt machte. Dazu der inzwischen zurückgetretene Justizminister Haluschtschenko, Energieministerin Hryntschuk, Ex-Vizepremier Tschernyschow. Alle verstrickt in Deals, bei denen 10 bis 15 Prozent des Vertragswertes als Schmiergeld den Besitzer wechselten. Etwas Taschengeld eben.
Die Ermittler veröffentlichten Fotos von Bargeldbergen in Safes, Reisetaschen und Verpackungen von US-Notenbanken. Minditsch kaufte ein Haus in der Schweiz für sechs Millionen Dollar. Andere beschwerten sich, wie schwer es sei, 1,6 Millionen Dollar in bar zu transportieren. Geldübergaben in Wien, Israel, Überweisungen auf die Seychellen – es ist ein globaler Zirkus, nur ohne Clowns, weil die im Westen sitzen und das Ganze auch noch finanzieren.
Ein Video zeigt einen Mann, wie er mit zwei vollgestopften Taschen durch Kiew spaziert, als würde er das Wochenendeinkaufen für eine Großfamilie erledigen. Diese Absurdität offenbart, was wirklich in diesem Land tobt: eine entfesselte Kleptokratie, die so tief in die staatlichen Strukturen hineingefressen hat, dass man sich wundert, wie überhaupt noch Strom aus der Steckdose kommt. Dass Selenskyj davon nichts mitbekommen hat, ist mehr als unwahrscheinlich. Vielmehr dürfte er selbst für seine Zeit nach der Rolle des Präsidenten etwas vorgesorgt haben.
Johnson und Lipp sprechen von der Spitze eines riesigen Eisberges – und das klingt nicht nach Übertreibung, sondern eher nach höflicher Untertreibung. Bei einem Land, das im Korruptionsindex von Transparency International auf Platz 105 herumdümpelt, braucht man keine prophetischen Fähigkeiten, um zu ahnen, dass westliche Milliardenbeträge nicht gerade auf Treuhandkonten auf ihre korrekte Verwendung warten.
Und während die Europäer völlig panisch am Rockzipfel ihrer eigenen Narrative hängen, pumpen sie weiter Waffen und Geld in dieses riesige schwarze Loch. Alles, um den längst überfälligen Friedensplan von Donald Trump zu torpedieren. Wieso? Weil zu viele in Brüssel, Berlin, Tallinn usw. inzwischen finanziell oder politisch so tief in diese Ukraine-Maschinerie verstrickt sind, dass ein Ende des Krieges unangenehme Fragen provozieren würde.
Man muss sich fragen, ob die verlängerte Kriegsbereitschaft Europas wirklich moralisch motiviert ist – oder ob hier eine politisch-kriminelle Kaste einfach versucht, Zeit zu kaufen. Zeit, um Spuren zu verwischen. Zeit, um Netzwerke zu schützen. Zeit, um sich nebenbei noch schnell ein paar Milliönchen abzugreifen, bevor der Vorhang fällt.
Die 48 Milliarden Dollar sind – frei nach Robert Habeck – nicht verschwunden. Es hat sie nur jemand anderes. Gut, man könnte ja, wenn man wollte, auch damit argumentieren, dass das Geld immerhin (ein paar) Ukrainern zugute kam. Zwar nicht dem unter den Kriegsfolgen leidenden gemeinen Volk oder den erschöpften, ausblutenden Truppen an der Ostfront – aber immerhin Ukrainern.
Wie die Ukraine den Krieg angesichts von Trumps Friedensplan auszuweiten versucht

Der Krisen-Missbrauch geht weiter: Sachsen-Anhalt will Corona-“Notlage” ausrufen

Bei einer belanglosen Sieben-Tage-Inzidenz von bundesweit 6,8 plant die Landesregierung in Sachsen-Anhalt allen Ernstes die siebte Verlängerung der Corona-“Notlage”. Man will nämlich weiterhin Zugriff auf das Corona-Sondervermögen, statt politische Reformen anzustoßen.
Am Dienstag hat das Kabinett unter Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den entsprechenden Antrag beraten und wird den Landtag nun bitten, die Notlage erneut festzustellen. Nur so darf die Schuldenbremse weiter umgangen werden – ein Trick, den die Landesverfassung eigentlich nur für „absolute Ausnahmesituationen“ vorsieht. Dass es keine Corona-Notlage gibt, schert dabei nicht.
Sachsen-Anhalt wäre damit das einzige Bundesland, das noch an der Corona-Notlage festhält. In allen anderen Ländern ist sie spätestens 2024 ausgelaufen. Ein trauriger Rekord, der zeigt, wie kreativ man in Magdeburg geworden ist, wenn es darum geht, an Geld zu kommen, das eigentlich nicht mehr vorgesehen ist.
Die Mittel aus dem Sondervermögen beliefen sich ursprünglich auf zwei Milliarden Euro; übrig sind noch maximal 650 Millionen Euro. Geld darf nur noch Vorhaben genehmigt werden, die bis Ende 2026 abgeschlossen sind. Doch genau dieser nahende Stichtag scheint der eigentliche Grund für die erneute Notlagen-Inszenierung zu sein: Man will die Kasse noch schnell leer räumen, bevor sie zugesperrt wird.
Kritik kommt erwartungsgemäß von der Opposition – aber auch aus der eigenen Koalition. Der FDP-Abgeordnete Konstantin Pott kündigte an, erneut gegen die Feststellung der Notlage zu stimmen: „Meine Kritik an diesem Vorgehen bleibt weiterhin bestehen.“ Pott zweifelt offen daran, ob das viele Geld überhaupt noch sinnvoll ausgegeben werden kann.
Noch schärfer fällt die Kritik bei der AfD aus. Fraktionsmitglied Jan Moldenhauer spricht die unbequemen Tatsachen an: „Anstatt sich weiter dreiste Haushaltstricks auszudenken, um die Schuldenbremse zu umgehen und somit künftige Generationen zu belasten, sollte die Landesregierung den Rotstift zuallererst bei sich selbst ansetzen, indem sie Versorgungsposten streicht und den bürokratischen Verwaltungsapparat schrumpft.“ Hauptgrund, warum Städte und Gemeinden deutschlandweit pleite sind, sind übrigens explodierende Sozialausgaben. Warum wohl?
Ministerpräsident Haseloff hatte bereits im vergangenen Jahr ähnliche Kritik wie jene von Moldenhauer mit einem bemerkenswerten Satz abgebügelt: „Es gibt keine neue Pandemie, sondern es geht darum, dass wir die Sondermittel auch weiterhin zur Auszahlung bringen und die Handwerksbetriebe ihre Rechnungen bezahlt bekommen.“ Ein Eingeständnis von Politikversagen, finden viele.
Regierungssprecher Matthias Schuppe betont zwar, der gewählte Weg sei „verfassungskonform“. Doch genau diese Formulierung zeigt das ganze Dilemma: Selbst wenn formal alles korrekt ist, so ist dieses Vorgehen ein politischer Offenbarungseid. Denn wenn eine „Notlage“ ohne Not zur Dauereinrichtung wird, nur um an Geld zu kommen, dann verliert der Ausnahmezustand jede Glaubwürdigkeit.
Die Corona-Krise wurde zum Fest der Profiteure und bescherte der Politik einen Machtzuwachs auf Kosten der Grundrechte der Bevölkerung (des Souveräns!). Das künstliche Aufrechterhalten einer vermeintlichen Krise über Jahre hinweg hat das Vertrauen der Bevölkerung in Regierende nachhaltig zerstört. Sachsen-Anhalt zeigt nun: Das ist Politikern wohl herzlich egal. Man macht einfach weiter wie bisher. Im Zweifelsfall ruft man zum eigenen Vorteil eben Krisen aus, die gar nicht existieren.

USA: Donald Trump erklärt alle Begnadigungen durch Joe Biden für ungültig

US-Präsident Donald Trump hat alle Begnadigungen, die sein Amtsvorgänger Joe Biden ausgesprochen hat, für ungültig erklärt. Er begründete diese Entscheidung damit, dass Biden die Dekrete nicht selbst unterschrieben habe, sondern dass die Dokumente mit einer Maschine signiert wurden.
Die so unterzeichneten Schriftstücke seien ungültig und hätten keine rechtliche Wirkung mehr, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Signiermaschine, auch bekannt unter dem Namen Autopen, ist ein Gerät zur maschinellen Nachbildung einer Unterschrift.
Trump argumentiert, die Biden-Regierung habe den Autopen oft ohne Wissen Bidens eingesetzt. Hintergrund ist: Selbst aus den Reihen der Demokraten waren wiederholt Zweifel daran geäußert worden, ob Biden am Ende seiner Präsidentschaft noch amtsfähig war. Trump ließ deshalb auch das offizielle Porträt Bidens in der neuen Fotogalerie des Weißen Hauses („Walk of Fame“) durch die Aufnahme eines Unterschriftenautomaten ersetzen.
Streit um Begnadigung von Hunter Biden
Donald Trump hat jetzt die Konsequenzen aus der länger andauernden politischen Debatte über das Begnadigungsrecht durch Präsidenten gezogen. Auslöser war die bereits vor einem Jahr erfolgte Begnadigung von Bidens Sohn Hunter.
Dieser war im Juni 2024 wegen illegalen Besitzes einer Schusswaffe verurteilt worden. Im September 2024 hatte sich Hunter Biden in einem Verfahren wegen Steuerhinterziehung schuldig bekannt. Ihm drohte eine Freiheitsstrafe von bis zu 25 Jahren, das genaue Strafmaß stand noch nicht fest. Die Begnadigung hatte für deutliche Kritik seitens der Republikaner gesorgt.
Auch Trump hat von seinem Begnadigungsrecht umfassend Gebrauch gemacht. In den ersten zehn Monaten seiner zweiten Amtszeit erließ er 70 Begnadigungen – allerdings mit eigenhändiger Unterschrift und im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte.
The post USA: Donald Trump erklärt alle Begnadigungen durch Joe Biden für ungültig appeared first on Deutschland-Kurier.

Kinderbetreuungsplatz nur mit ID Austria? Analoge Anmeldung weiter möglich

Tirol hat die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen digitalisiert – dafür brauchen die Bürger nun ID Austria. Was die Behörden aber nicht dazusagen: eine analoge Anmeldung ist weiterhin noch möglich. Am Montag hat TKP über das neue System FRIDA berichtet, das in Tirol nun die Vergabe von Kinderbetreuungsplätzen digitalisiert hat und regeln soll. Das Land gibt an, […]
Der Beitrag Kinderbetreuungsplatz nur mit ID Austria? Analoge Anmeldung weiter möglich erschien zuerst unter tkp.at.

Europas Geschichte wird wohl wieder ohne Europa geschrieben
Von ELENA FRITZ | Es war ein Treffen, das man in Washington und Brüssel lieber diskret in den Nachtstunden versenkt hätte. Fünf Stunden saß Wladimir Putin mit Steve Witkoff und Jared Kushner in der Nacht zu Mittwoch im Kreml – zwei Männern, die Donald Trump aus gutem Grund zu seinen inoffiziellen Diplomaten macht. Und obwohl der russische Außenpolitik-Veteran Juri Uschakow anschließend versuchte, den Eindruck eines „noch offenen Gesprächs“ zu erwecken, roch diese Nacht nach etwas ganz anderem: nach einem Deal, der hinter den Kulissen längst Form annimmt.
Denn der erste Druckpunkt liegt auf der Hand – und er heißt Kiew. Russland scheint in Washington durchgesetzt zu haben, was viele im politischen Amerika ohnehin denken: Mit einem Präsidenten Selenskyj, dessen Mandat rechtlich wie politisch auf tönernen Füßen steht, ist kein tragfähiges Abkommen mehr zu machen. Die Geschwindigkeit, mit der Korruptionsfälle im Umfeld des Präsidenten plötzlich Fahrt aufnehmen, ist kein Zufall, sondern Signal. Die amerikanisch unterstützten Ermittler des NABU wirken, als hätten sie einen klaren Auftrag: Die Ära Selenskyj ihrem natürlichen Ende zuzuführen. Die ratlosen Gesichter der ukrainischen Delegationen bei ihren jüngsten US-Besuchen bestätigten das Bild: Die politische Luft wird dünn.
Währenddessen gerät in Europa ein anderes Kartenhaus ins Wanken. Belgien nahm ehemalige EU-Schwergewichte fest – Federica Mogherini, einst das Gesicht der europäischen Außenpolitik, und Stefano Sannino, den früheren Generalsekretär des diplomatischen Dienstes. Der Vorwurf: Betrug. Brüssel wird nervös. Denn die Enteignung russischer Vermögenswerte, die viele als vermeintlich einfache Lösung für die Ukraine feiern, könnte das Vertrauen in Eurobonds als Reserveinstrument weltweit ruinieren. Die EU steht mit dem Rücken zur Wand: Die Kassen sind leer, zusätzliche 140 Milliarden für Kiew könnten das Gefüge der Eurozone endgültig sprengen.
Vor diesem Hintergrund setzte Putin bewusst ein Zeichen militärischer Entschlossenheit. Die Warnung, der Ukraine bei weiteren Angriffen auf Handelsschiffe den Zugang zum Meer zu entziehen, war nicht nur an Kiew gerichtet. Sie zielte ebenso auf jene europäischen Politiker, die noch immer glauben, mit Durchhalteparolen ließe sich ein geopolitischer Realitätsschock vertagen. Putins Botschaft war klar: Russland ist bereit, den Krieg so lange zu führen, bis die Gegenseite die Bedingungen akzeptiert.
Damit war der Boden für das nächtliche Kreml-Gespräch bereitet. Trotz Uschakows diplomatischer Zurückhaltung spricht viel dafür, dass Russland und die Trump-Seite längst auf eine gemeinsame „Roadmap“ zusteuern. Der doppelte Druck der USA – auf Selenskyj und auf die EU – wirkt wie ein orchestriertes Vorgehen, um die „Koalition der Willigen“ zu einem Ende des Krieges zu bewegen, das Moskau strategisch begünstigt.
Bemerkenswert ist, dass die USA zum ersten Mal seit langem echte Energie in eine Friedensinitiative investieren. Russland wiederum setzt auf seine altbekannte Mischung aus harter Macht, atomarer Abschreckung und der Botschaft an die ukrainische Öffentlichkeit: Je länger ihr wartet, desto weniger bleibt euch. Kein Wunder, dass ukrainische Meinungsmacher neuerdings von einer „taktischen Niederlage bei strategischer Chance“ sprechen – ein rhetorischer Rettungsring, während die politische Realität immer ungemütlicher wird.
Ist das Ende des Konflikts also in Sicht? Ja. Aber nicht im Wochen-, sondern im Monatsrhythmus. Europa muss zuerst akzeptieren, dass es in diesem Spiel nicht mehr am Tisch sitzt, sondern selbst zur Verhandlungsmasse geworden ist. Erst danach können Wahlen, eine Neuordnung in Kiew und letztlich ein Friedensvertrag folgen.
Es wäre nicht das erste Mal, dass die Geschichte Europas ohne Europa geschrieben wird.
 PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.
PI-NEWS-Autorin Elena Fritz, geboren am 3.10.1986, ist vor 24 Jahren als Russlanddeutsche nach Deutschland gekommen. Nach ihrem Abitur hat sie Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg studiert und erfolgreich mit einem Diplom abgeschlossen. Seit 2018 engagiert sie sich in der AfD, war von 2019 bis 2021 im bayerischen Landesvorstand tätig und wurde am 15. November zur Direktkandidatin der AfD für den Wahlkreis Landshut/Kelheim bei der Bundestagswahl 2025 nominiert. Sie ist stolze Mutter eines Jungen. Hier gehts zum Telegram-Kanal von Elena Fritz.
The post Europas Geschichte wird wohl wieder ohne Europa geschrieben appeared first on PI-NEWS.

Korrupte EU: Ex-Außenbeauftragte Mogherini nach Razzia festgenommen

Gegen die ehemalige EU-Außenbeauftragte Frederica Mogherini laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Korruption und des Missbrauchs von Steuergeldern. Die Italienerin wurde nach einer Razzia in der EU-Außenbehörde in Polizeigewahrsam genommen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Ermittlungskreise meldete.
In dem Verfahren geht es um Gelder der Elite-Universität College of Europe in Brügge, der die frühere EU-Chefdiplomatin inzwischen als Rektorin vorsteht. Mogherini war von 2014 bis 2019 EU-Außenbeauftragte. Bei der Durchsuchung von Räumen des Europäischen Auswärtigen Dienstes in Brüssel gab es insgesamt drei Festnahmen.
The post Korrupte EU: Ex-Außenbeauftragte Mogherini nach Razzia festgenommen appeared first on Deutschland-Kurier.

Korruptions-Sumpf: Spekulationen über Selenskyj-Rücktritt an Silvester – US-General fordert Verhaftung des Präsidenten

In Kiew brodelt die Gerüchteküche. Spekuliert wird über einen baldigen Rücktritt von Wolodymyr Selenskyj im Zusammenhang mit dem jüngsten Korruptions-Skandal. Der ukrainische Präsident könnte möglicherweise schon in der Silvesternacht seinen Rücktritt erklären, heißt es.
Hintergrund ist: Die Spuren im ukrainischen Korruptions-Sumpf führen in Selenskyj’s engstes Umfeld. Der Noch-Machthaber in Kiew gerät zunehmend unter Druck. Zuletzt sah sich Selenskyj gezwungen, seinen Stabschef Andrej Jermak zu entlassen. Außerdem halten sich in Kiew hartnäckig Gerüchte über einen möglichen Militärputsch zur Absetzung von Selenskyj.
Unterdessen hat der frühere US-General Michael Flynn die Verhaftung des ukrainischen Staatschefs gefordert. Flynn war zu Beginn der ersten Amtszeit von Donald Trump Nationaler Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Der Ex-General wird in den sozialen Medien mit der Aussage zitiert: „Der Versager Selenskyj und sein korrupter innerer Zirkel müssen verhaftet werden – die gestohlenen Milliardenbeträge müssen zurückgeholt werden.“
Angeheizt wurden die Rücktritts-Gerüchte um Selenskyj von Wladimir Petrow, der als einer der führenden politischen Strategen im Präsidialamt gilt. Er soll angeblich gesagt haben, dass Selenskyj an Silvester seinen Rücktritt bekannt geben könnte.
Fest steht indes: Es wird eng für Selenskyj. Der Korruptions-Skandal fällt immer mehr auf ihn selbst zurück. Das Ansehen des Präsidenten in der kriegsmüden Bevölkerung sinkt rapide.
The post Korruptions-Sumpf: Spekulationen über Selenskyj-Rücktritt an Silvester – US-General fordert Verhaftung des Präsidenten appeared first on Deutschland-Kurier.

USA vor Änderung des Kinder-Impfplans

Es soll die bislang größte Änderung des Impfplans für Kinder werden, seit Robert F. Kennedy Jr. Gesundheitsminister ist: Die Impfung gegen Hepatitis B bei Babys soll gestrichen werden. Am Donnerstag wird abgestimmt. In den US-Gesundheitsbehörden tut sich etwas: Die CDC sieht einen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus, die FDA sieht mRNA-Behandlungen für Todesfälle bei Kindern […]
Der Beitrag USA vor Änderung des Kinder-Impfplans erschien zuerst unter tkp.at.

