Kategorie: Nachrichten
Weltwoche Daily: Von der Leyen will Truppen in Ukraine schicken
„Weltwoche Daily Deutschland“ – Roger Köppels täglicher Meinungs-Espresso gegen den Mainstream-Tsunami. Von Montag bis Freitag ab 6:30 Uhr mit der Daily-Show von Köppel und pointierten Kommentaren von Top-Journalisten. Die Themen in dieser Ausgabe:
- Von der Leyen will Truppen in die Ukraine schicken.
- Österreich: Kranke Wirtschaft, Regierung in der Kritik.
- Großbritannien: Protest gegen Asylhotels.
- US-Gericht bremst Trump-Zölle.
- Klimawandel setzt Hai-Zähnen zu. Wirklich?
- EU dürfte der EU nicht beitreten – zu undemokratisch.
- Zürcher Kantonsrat streicht Frühfranzösisch: Nicht verzweifeln!
- Migration und Asyl in der Weltwoche!
- Juso-Erbschaftssteuern: Familienunternehmer wehren sich.
The post Weltwoche Daily: Von der Leyen will Truppen in Ukraine schicken appeared first on PI-NEWS.

Trump hinterfragt Erfolg von Operation Warp Speed: Hat Pfizer die Wahrheit gesagt?

Fast fünf Jahre hören wir nun schon von den Konzernmedien, Politikern und der Pharmalobby wie wirksam und sicher die Covid-mRNA-Spritzen doch seien. Nun hinterfragt Präsident Trump erstmals öffentlich, ob das auch tatsächlich stimmt, oder ob die Kritiker recht haben. In einem Truth Social Posting stellt Trump nun die Frage nach der Wahrheit. Der wichtigste Satz […]
Der Beitrag Trump hinterfragt Erfolg von Operation Warp Speed: Hat Pfizer die Wahrheit gesagt? erschien zuerst unter tkp.at.

Trotz Gavin Newsoms großzügiger Spende für grüne Energie zählen die kalifornischen Städte zu den schmutzigsten in Amerika

![]()
Audrey Streb, DCNF-Energiereporter, 27. August 2025
Kalifornische Städte zählen zu den schmutzigsten Städten in Amerika. Zehn Städte im Golden State weisen laut der Rasenpflege-Website LawnStarter die schlechteste durchschnittliche Luftqualität in den USA auf.
San Bernardino wurde der Analyse von LawnStarter zufolge zur schmutzigsten Stadt Amerikas gekürt, Los Angeles liegt dicht dahinter. Obwohl der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, sich für ehrgeizige Klimaziele einsetzt, die zu strengen Vorschriften geführt und Milliarden in Initiativen für grüne Energie versenkt haben, zählen zahlreiche Städte seines Bundesstaates laut LawnStarter immer noch zu den am stärksten verschmutzten Städten Amerikas.
„San Bernardino, Kalifornien, ist das zweite Jahr in Folge die schmutzigste Stadt. Von allen Städten in unserem Ranking hat San Bernardino den höchsten Anteil an Einwohnern, die mit der Umweltverschmutzung unzufrieden sind – 75 % – und liegt gleichauf mit neun anderen kalifornischen Städten mit der schlechtesten durchschnittlichen Luftqualität.“ (VERBUNDEN: Müllberge begraben die Geburtsstätte Amerikas, während Gewerkschaft Lohnerhöhung fordert)
Mehrere andere Städte, darunter Detroit (Michigan) und Reading (Pennsylvania), zählen laut LawnStarter zusammen mit Los Angeles zu den schmutzigsten Städten der USA. Zwei weitere kalifornische Städte, Ontario und Corona, schafften es laut der Analyse unter die Top Ten.
LawnStarter hat die 500 größten US-Städte mit ausreichend verfügbaren Daten bewertet und sie nach vier Faktoren bewertet – Umweltverschmutzung, unzureichende Lebensbedingungen, schlechte Abfallinfrastruktur und Unzufriedenheit der Einwohner – bevor die Gesamtplatzierung jeder Stadt auf einer Skala von 1 bis 100 ermittelt wurde, so das Unternehmen.
Bemerkenswert ist, dass die zehn Städte in den USA mit den höchsten Treibhausgasemissionen (THG) pro Kopf laut LawnStarter nicht unter die zehn schmutzigsten oder am stärksten verschmutzten Städte kamen.
Der Analyse zufolge sammelten lokale College-Studenten in diesem Jahr in ganz San Bernardino 500 Pfund Müll, und die Obdachlosenkrise in Los Angeles hielt trotz zahlreicher Aufräumversuche [und Angebote auf Hilfe] an.
Newsom drängt auf ehrgeizige Ziele für grüne Energie und prahlt auf seiner Website damit, dass Kaliforniens Stromnetz durchschnittlich sieben Stunden am Tag zu 100 % mit „ sauberer Energie “ betrieben wird und dass der Staat den „ehrgeizigsten Aktionsplan zum Klimaschutz der Welt“ habe . Energiepolitikexperten bringen diese Initiative für grüne Technologien auch mit den stark steigenden Energiekosten im Staat in Verbindung. Diese werden voraussichtlich noch weiter steigen, da sich zwei große Raffinerien darauf vorbereiten, unter der Belastung durch die strengen staatlichen Vorschriften ihre Geschäftstätigkeit zu reduzieren, wie Branchenexperten anmerken.
Newsoms Büro reagierte nicht auf die Bitte der Daily Caller News Foundation um einen Kommentar.
Ergänzung: Benzinpreise in USA https://gasprices.aaa.com/
Alle Inhalte der Daily Caller News Foundation, einem unabhängigen und überparteilichen Nachrichtendienst, stehen seriösen Nachrichtenverlagen mit großem Publikum kostenlos zur Verfügung. Alle veröffentlichten Artikel müssen unser Logo, den Namen des Reporters und seine DCNF-Zugehörigkeit enthalten. Bei Fragen zu unseren Richtlinien oder einer Partnerschaft mit uns wenden Sie sich bitte an licensing@dailycallernewsfoundation.org .
Der Beitrag Trotz Gavin Newsoms großzügiger Spende für grüne Energie zählen die kalifornischen Städte zu den schmutzigsten in Amerika erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.
Wenn Friedrich Merz über Russland spricht…

NiUS-LIVE: Mysteriöses Wahl-Phänomen – Sechs AfD-Kandidaten tot

Jeden Morgen von 7 bis 9 Uhr beleuchtet Moderator Alex Purrucker die Themen, die Millionen Menschen bewegen und über die Deutschland spricht. Am Dienstag begrüßt er die Kolumnistin Birgit Kelle und NiUS-Reporter Julius Böhm im Studio.
Die Themen heute:
- Erste Merz-Afghanen in Deutschland eingetroffen. Doch einige verpassten den Flieger wegen Shopping.
- Immer mehr Offizielle in Friedland verharmlosen den brutalen Tod der 16-Jährigen Liana K. und warnen vor “rechter Hetze”.
- Mehr Geld für Demokratie leben! Jetzt schreibt Ministerin Prien einen Rechtfertigungs-Brief an die Abgeordneten.
The post NiUS-LIVE: Mysteriöses Wahl-Phänomen – Sechs AfD-Kandidaten tot appeared first on PI-NEWS.
PROPAGANDA-FORSCHUNG – »Lügen-Narrative« des Westens um einen Krieg zu rechtfertigen!
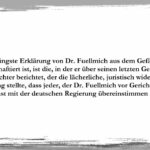
Dr. Reiner Fuellmich: Ein verfolgter Held des Widerstands – Bert Olivier
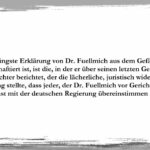
Im weiteren Verlauf des Artikels berichtet Fuellmich, wie der Untersuchungsausschuss zum Coronavirus gegründet und wie…
The post Dr. Reiner Fuellmich: Ein verfolgter Held des Widerstands – Bert Olivier first appeared on Axel B.C. Krauss.
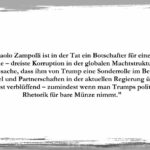
First Friends: Wie der Berater des Präsidentenpaares vom Model-Mogul zum Sonderbeauftragten wurde – Whitney Webb, Mark Goodwin
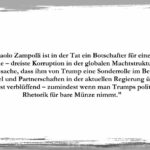
Unlimited Hangout untersucht, wie Paolo Zampolli trotz seiner Vergangenheit, in der er korrupte, räuberische und…
The post First Friends: Wie der Berater des Präsidentenpaares vom Model-Mogul zum Sonderbeauftragten wurde – Whitney Webb, Mark Goodwin first appeared on Axel B.C. Krauss.
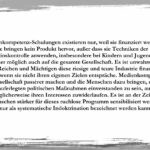
Medienkompetenz 2025 – Judith Brown
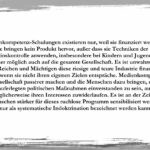
Quelle: Media Literacy 2025 – Propaganda In Focus Psychologische Operationen der Regierung Im Laufe…
The post Medienkompetenz 2025 – Judith Brown first appeared on Axel B.C. Krauss.
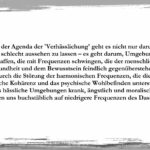
Die Agenda der Verschandelung: Wie Oligarchen Architektur als Waffe einsetzten – Unbekoming
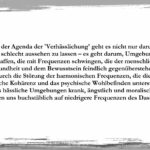
Quelle: The Uglification Agenda: How Oligarchs Weaponized Architecture Vorwort Dieser Aufsatz stützt sich in…
The post Die Agenda der Verschandelung: Wie Oligarchen Architektur als Waffe einsetzten – Unbekoming first appeared on Axel B.C. Krauss.
Restart Democracy – Schluss mit staatlicher Willkür (Interview mit Markus Bönig)

Ex-Admiral Schönbach über die innenpolitische Lage in Deutschland

Mit dem ehemaligen Inspekteur der Marine, Kay-Achim Schönbach, hat der Bestsellerautor Stefan Schubert auf seinem YouTube-Kanal “Schuberts Lagemeldung” einen hochkarätigen Besuch zu Gast. Das Gespräch beleuchtet die Hintergründe, warum Schönbach im Januar 2022 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde.
Seine damalige Analyse zum ukrainisch-russischen Konflikt wurde von der aktuellen Weltlage längst bestätigt, doch sein Appell an gemeinsame geostrategische Interessen und die Äußerungen über das „christliche Russland“ waren für das links-grüne Netzwerk in Berlin der Wahrheit zu viel.
Auch eines der wichtigsten Bücher der letzten Jahrzehnte „Die einzige Weltmacht“ von Zbigniew Brzeziski, die innenpolitische Lage in Deutschland, der Zustand der CDU, Wehrpflicht und die zukünftige Entwicklung der AfD-Brandmauer wird besprochen.
The post Ex-Admiral Schönbach über die innenpolitische Lage in Deutschland appeared first on PI-NEWS.

