Kategorie: Nachrichten

USA führen Wirtschaftskrieg gegen die ganze Welt?

Die US-Wirtschaftspolitik ist klar: Die USA muss “gewinnen”, d.h. eindeutig einen Vorteil haben. Es gibt keine “gemeinsamen Interessen” oder “Win-Win”-Situationen, sondern “The winner takes it all”. Was nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg gegen die ganze Welt ist, wie Vertreter des Multipolarismus erklären. Die USA wehren sich so vehement gegen die neue multipolare Weltordnung nicht nur […]
Der Beitrag USA führen Wirtschaftskrieg gegen die ganze Welt? erschien zuerst unter tkp.at.
Epstein-Skandal: Die große Ablenkung – Das Netzwerk bleibt im Dunkeln

Australier bremsen Absatz von Elektroautos: Jüngste Fahrer haben eine „stärkere Bindung“ zu Autos mit Verbrennungsmotor.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volvo_EX30_Cross_Country_IAA_2025_DSC_1356.jpg
Von Jo Nova
Die guten Nachrichten für den erzwungenen Übergang zu Elektroautos reißen nicht ab.
Die neuesten Umfragen zeigen, dass die Australier rapide das Interesse am Kauf von Elektrofahrzeugen verlieren (selbst wenn diese das Wetter in hundert Jahren schöner machen sollten):
Australische Autofahrer bremsen den Absatz von Elektrofahrzeugen aufgrund von Batteriekostenängsten. [Bezahlsperre]
Der australische Markt für Elektrofahrzeuge steckt in einer Krise. Viele Autofahrer zögern mit Neukäufen, da sie versteckte Kosten und die langfristige Zuverlässigkeit der Batterien befürchten. Eine neue Umfrage von Carsales, Australiens größtem Online-Autoportal, zeigt, dass das Interesse der Verbraucher an batteriebetriebenen Fahrzeugen trotz des harten Wettbewerbs zwischen dem chinesischen Hersteller BYD und Tesla nachlässt.
Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber das (unten) klingt, als ob ein Verkäufer von Elektrofahrzeugen versucht, nicht zu sagen, dass 64 % der Australier ein Elektrofahrzeug nicht einmal in Erwägung ziehen würden:
Die jüngste EV-Verbraucherumfrage von Carsales *) hat ergeben, dass die Bereitschaft australischer Autofahrer, sich für Elektrofahrzeuge zu interessieren, bei 36 Prozent stagniert, was den abrupten Stillstand des Marktes verdeutlicht.
Einer anderen Quelle zufolge sind es jedoch 70 %, die den Kauf eines Elektrofahrzeugs nicht in Erwägung ziehen.
Die Bereitschaft, sich jemals ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, ist erneut gesunken; nur noch 30 % der Befragten haben jemals ein Elektrofahrzeug in Erwägung gezogen. Dieser anhaltende Rückgang von 56 % (Juni 2022) dürfte die gestiegenen Lebenshaltungskosten und das sinkende verfügbare Einkommen des Durchschnittsbürgers widerspiegeln.
Eine Gegenreaktion auf das Hightech-Fahrzeug
Interessanterweise sind die Millennials (25-35 Jahre) zwar die Altersgruppe, die am ehesten den Kauf eines Elektrofahrzeugs in Erwägung zieht, ihre jüngeren Geschwister der Generation Z (18-24 Jahre) hängen jedoch eher an Benzinmotoren:
Einige Autofahrer, insbesondere die Generation Z – geboren zwischen 1997 und 2012 – gaben an, eine stärkere Verbundenheit zu traditionellen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu haben. Herr Booth fand dies kontraintuitiv und erklärte: „Man sollte meinen, dass sie technologisch fortschrittlicher wären, da sie damit aufgewachsen sind … aber das scheint eher ein Rückschritt zu sein.“
Vielleicht haben sie von dem jüngsten Rückruf der Volvo-Elektrofahrzeuge gehört? Die unglücklichen Besitzer einjähriger Autos wurden angewiesen, ihre Fahrzeuge nicht über 70 % aufzuladen, da Brandgefahr besteht. Beunruhigender Weise gibt es noch keine Lösung. Volvo versichert, die Besitzer zu informieren, sobald eine Lösung verfügbar ist. Na, ist das nicht beruhigend?
Fast 3000 Besitzer von Volvo-Elektrofahrzeugen haben nun also „auf unbestimmte Zeit“ eine deutlich geringere Reichweite.
Wie MGuy betont, folgt dies unmittelbar auf den großen Rückruf von Mercedes wegen desselben Brandrisikos.
Es ist kein Zufall, dass die Labour-Regierung gerade erst Geldgeschenke angekündigt hat, damit mehr Reiche ein Elektroauto kaufen können:
Die Labour-Partei greift angesichts knapper werdender Budgets auf günstige Kredite zurück, um die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu stützen.
Steuerzahler, die sich für ein neues Elektrofahrzeug entscheiden, erhalten einen Zuschuss von 1900 Dollar. Dies ist der jüngste Versuch der Albanese-Regierung, die Akzeptanz zu steigern und die Autofahrer an die ehrgeizigen Klimaziele der Labour-Partei anzupassen.
Im Rahmen eines Rabattkreditprogramms erhalten Elektrofahrzeuge, deren Preis unterhalb der Luxusauto-Steuergrenze von 91.378 US-Dollar liegt, Zinsnachlässe zwischen 0,5 und 1 Prozentpunkt.
Egal wie die Frage lautet, die Antwort ist immer, den Armen die Kaufkraft zu rauben und sie den Freunden der Labour-Partei in den Innenstädten zu geben.
________________
*) Carsales befragte vom 4. bis 11. November 2025 insgesamt 2299 Personen.
Foto: Alexander-93
Der Beitrag Australier bremsen Absatz von Elektroautos: Jüngste Fahrer haben eine „stärkere Bindung“ zu Autos mit Verbrennungsmotor. erschien zuerst auf EIKE – Europäisches Institut für Klima & Energie.

Trump setzt Selenskyj unter Druck: Präsidentschaftswahlen in der Ukraine „vor dem 15. Mai“!
 (David Berger) Ein brisanter Bericht der Financial Times enthüllt, dass die Trump-Regierung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj massiv unter Druck setzt. Demnach soll Kiew „vor dem 15. Mai“ Präsidentschaftswahlen abhalten – andernfalls drohten die USA, ihre Sicherheitsgarantien für das Land zurückzuziehen. Die Nachricht sorgt international für Alarm, ja dürfte bei den Selenskyj-Jüngern auch in Deutschland […]
(David Berger) Ein brisanter Bericht der Financial Times enthüllt, dass die Trump-Regierung den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj massiv unter Druck setzt. Demnach soll Kiew „vor dem 15. Mai“ Präsidentschaftswahlen abhalten – andernfalls drohten die USA, ihre Sicherheitsgarantien für das Land zurückzuziehen. Die Nachricht sorgt international für Alarm, ja dürfte bei den Selenskyj-Jüngern auch in Deutschland […]
Der Beitrag Trump setzt Selenskyj unter Druck: Präsidentschaftswahlen in der Ukraine „vor dem 15. Mai“! erschien zuerst auf Philosophia Perennis.

Die Realität in unseren Zügen: Zugbegleiter packt über Gefahren und Missstände aus

Der tödliche Angriff auf Schaffner Serkan C. hat dafür gesorgt, dass auch die Politik die zunehmende Gewalt im Bahnverkehr aufgreift. Doch erkennen Regierende die Probleme an? Wir haben mit Zugbegleiter Rocco M. über die Gefahren in seinem Berufsalltag gesprochen. Im Interview spricht er Klartext darüber, von welchen Gruppen die meisten Probleme ausgehen und wie das Personal beim Warten auf die Bundespolizei auf sich allein gestellt ist, wenn Situationen wie Fahrkartenkontrollen eskalieren. Und er macht deutlich: Hier arbeiten Menschen für Menschen. Sie bestmöglich zu schützen, muss selbstverständlich sein.
Ein Interview von Vanessa Renner
Lange wurde der Bahnverkehr vor allem mit Ärger über Verspätungen und Zugausfälle assoziiert. Inzwischen rückt infolge etlicher brutaler Angriffe auch die mangelnde Sicherheit an Bahnhöfen und in den Zügen stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Eine Berufsgruppe, die diese Zustände täglich ausbaden muss, sind Zugbegleiter. Der Tod von Serkan C., der von einem Schwarzfahrer bei einer Fahrkartenkontrolle brutal attackiert wurde und später seinen schweren Verletzungen erlag, sorgt landesweit für Entsetzen. Der Täter war Berichten zufolge schon zuvor in einem anderen Zug durch aggressives Verhalten aufgefallen – die Bundespolizei rückte zwar an, doch das Randalieren blieb für den Mann ohne Konsequenzen. Stunden später attackierte er dann Serkan C.
Rocco M. aus Berlin arbeitet seit 2020 als Zugbegleiter, zunächst im Fern- und inzwischen im Regionalverkehr. Er übt seinen Beruf mit Feuereifer aus und schätzt den täglichen Menschenkontakt. Doch auch er wurde bei der Ausübung seiner Tätigkeit schon bedroht und kennt die Gefahren, die der Job mit sich bringt, aus eigener Erfahrung. Mit uns sprach er über typische Problemgruppen, wie das Personal versucht, Eskalationen zu vermeiden, und über die mangelnde Präsenz der Bundespolizei.
Rocco macht auch deutlich: Hinter der Uniform steckt kein anonymes „Bahnpersonal“, sondern hier arbeiten Menschen für Menschen, und zwar mit vollem Engagement – allen Widrigkeiten zum Trotz. Sie sorgen für Ordnung, lösen Probleme und geben Orientierung im vom Chaos geprägten Bahnalltag. Dafür erhalten sie zu wenig Schutz und werden so zu Opfern von falschen Prioritäten und einer verfehlten und realitätsfernen Politik.
Der gefährliche Alltag der Zugbegleiter: “Er zog direkt ein Messer”
Report24: Die Sicherheit von Zugbegleitern ist nach dem grausamen Tod von Serkan C. in aller Munde. Die Politik hat ihre Beileidsfloskeln produziert, doch es steht zu befürchten, dass das Thema rasch wieder in Vergessenheit geraten wird – bis wieder etwas passiert. Rocco, du arbeitest seit 2020 als Zugbegleiter, inzwischen vor allem in und um Berlin, und hast in dieser Zeit einiges erlebt. Wie sicher fühlst du dich, wenn du zur Schicht aufbrichst?
Rocco: Das variiert stark nach Tageszeit. Spätabends und nachts fühle ich mich deutlich unsicherer als tagsüber. Man merkt auch, dass zu später Stunde mehr Problemklientel unterwegs ist.
Report24: Bist du selbst schon in brenzlige Situationen geraten?
Rocco: Ja. Vor knapp einem Jahr, hatte ich die Situation, dass am Endbahnhof noch jemand im Zug war. Es war kurz nach Mitternacht und die letzte Fahrt vor dem Feierabend. Ein Team von der DB-Sicherheit war mit an Bord. Ich weckte die Person, und derjenige wachte auf und zog direkt ein Messer. Ich halte generell immer Abstand zu den Fahrgästen, gerade wenn jemand schläft. Und das war auch gut so, wie sich wieder einmal bestätigte. Ich war in dem Moment wie gelähmt. Ein Kollege von der DB-Sicherheit rief nur laut „Pack das Messer weg“. Was er dann auch machte. Dann stieg er aus dem Zug und verließ den Bahnsteig.
Männer aus arabischem und osteuropäischem Raum treten aggressiv auf
Report24: Gerade bei den Fahrkartenkontrollen steht ihr direkt an der Front. Nach vielen Jahren im Beruf hast du sicher schon ein gutes Gespür dafür entwickelt, wer Probleme verursachen könnte und wer nicht, oder? Woran erkennst du schwierige Fahrgäste, bei denen du besonders vorsichtig sein musst? Welche Gruppen stechen heraus?
Rocco: Problempersonen sind meist Betrunkene, Jugendgruppen, Fußballfans (dabei meist die sogenannten „Ultras“) und Männer arabischer und osteuropäischer Herkunft.
Report24: Bemerkst du Unterschiede im Aggressions- und Gefahrenpotenzial je nach Migrationshintergrund der Fahrgäste?
Rocco: Da merkt man deutliche Unterschiede. Während Fahrgäste mit asiatischem Migrationshintergrund völlig problemlos sind, treten gerade die genannten Männer aus arabischem und osteuropäischem Raum aggressiv auf. Die strahlen zum Teil ihre Aggression schon aus. Ich möchte dabei betonen, dass dies nicht pauschal für alle gilt, aber man spürt da auf jeden Fall eine deutlich vermehrte Frequenz.
Sicherheit geht vor: Verzicht auf Kontrollen bei Problempersonen
Report24: Verzichtet ihr eurer Sicherheit (und der Sicherheit der anderen Passagiere) zuliebe bei den kritischen Klientelen manchmal auf Kontrollen?
Rocco: Ja, definitiv. Bei der Ausübung unserer Tätigkeit, haben wir durch unsere Präsenz im Zug alle Fahrgäste im Blick. Und wenn Problempersonen dabei sind, dann verzichte ich gezielt auf die Kontrolle bei genau eben dieser Person, und mache lieber im nächsten Wagen weiter.
Report24: Auch Migranten aus den Erstaufnahmeeinrichtungen und Flüchtlingsheimen nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel. Ist es ein Klischee, dass diese Menschen häufig ohne Ticket fahren, oder deckt sich das mit deinen Beobachtungen?
Rocco: Ja, kann ich so bestätigen. Bei der Aufnahme der Kontaktdaten, um eine Fahrpreisnacherhebung auszustellen, bekommt man dann oft einen Aufenthaltstitel im Scheckkartenformat vorgehalten.
Report24: Eine fehlende Fahrkarte ist es ganz sicher nicht wert, dass ihr euer Leben riskiert. Ungerecht ist es aber schon, wenn der brave Normalbürger für sein Ticket zahlt, während Problemgruppen praktisch kostenlos fahren, oder? Müssen gewohnheitsmäßige Schwarzfahrer mit Konsequenzen rechnen oder fehlt es an abschreckenden Strafen?
Rocco: Ja, das ist definitiv ungerecht, ich zahle auch wie jeder andere mein Ticket und da erwarte ich nicht nur als Zugbegleiter, sondern auch als zahlender Fahrgast, dass andere das genauso machen. Aber meine eigene Sicherheit hat da Vorrang. Und ich bin da ganz ehrlich, bei den restlichen Verkehrsmitteln, wie z.B. Straßenbahn und U-Bahn, wird auch nur stichprobenartig kontrolliert. Von daher denke ich, wird das System es verkraften, wenn ich nicht jeden einzelnen kontrolliere. Meist nutze ich die Möglichkeit, Fahrgäste ohne Fahrschein direkt von der Fahrt auszuschließen und des Zuges zu verweisen. Wenn dann jemand nicht freiwillig den Zug verlässt, wird die Bundespolizei dazu gerufen, und spätestens dann werden auch die Personalien aufgenommen für die Fahrpreisnacherhebung. Dann wird es für denjenigen richtig teuer.
Ich denke, das Strafmaß für Schwarzfahrer ist an sich schon ganz okay. Immerhin kann es bei Wiederholungstätern nicht nur zu Geldstrafen, sondern sogar zur Freiheitsstrafe kommen. Was mindestens erfolgt, ist der Eintrag ins Führungszeugnis nach spätestens der dritten Fahrt ohne gültigen Fahrschein.
Zu schwache Präsenz der Bundespolizei und langes Warten auf Hilfe
Report24: Ihr macht regelmäßig Schulungen und absolviert auch Deeskalationstrainings. Wenn nun aber trotz aller Vorsicht eine Situation eskaliert: Wie schnell ist die Bundespolizei bei euch?
Rocco: In Ballungsgebieten und größeren Ortschaften geht das relativ schnell, im ländlichen Raum kann es schon mal vorkommen, dass man 30 Minuten oder länger wartet, bis die Bundespolizei vor Ort ist. Wenn es ganz schlecht läuft, kommt niemand.
Report24: Hast du den Eindruck, dass die Bundespolizei ausreichend gut aufgestellt und präsent ist, um für Sicherheit zu sorgen? Gibt es zusätzliche Sicherheitskräfte, die euch unterstützen?
Rocco: Die Präsenz der Bundespolizei lässt sehr zu wünschen übrig. Man kann es oft beobachten, dass im Berliner Hauptbahnhof zwischen 9 und 18 Uhr mehrere Streifen mit Maschinengewehr im Anschlag unterwegs sind, und um 23 Uhr sieht man niemanden mehr und ist sich selbst überlassen. Zusätzlich zur Bundespolizei haben wir noch unsere Teams der DB-Sicherheit. Deren Präsenz ist aber auch noch ausbaufähig.
Report24: Zivilcourage ist leider nicht ungefährlich. Stärken euch dennoch auch mal andere Fahrgäste den Rücken?
Rocco: Das stimmt, aber es soll sich auch niemand selbst in Gefahr bringen. Es kommt selten vor, dass Fahrgäste sich aktiv für uns einsetzen, aber ich selbst habe schon Fahrgäste an Bord gehabt, die eingeschritten sind, gerade in Fällen, wo andere mich verbal angegangen haben.
Bahn investiert lieber 7 Millionen Euro in Werbespots statt in Sicherheit
Report24: Aktuell sorgt eine Werbekampagne der Bahn mit Anke Engelke für Negativschlagzeilen: 7 Millionen Euro kosteten die Spots, die bekannte Bahn-Probleme auf die Schippe nehmen. Wie hätte man das Geld deiner Meinung nach besser investieren können? Wie könnte man die Sicherheit für euch und andere Mitarbeiter und für die Passagiere in Zügen und auf Bahnhöfen erhöhen?
Rocco: Solche Sachen ärgern mich. Vieles, was uns Personal helfen würde, wird abgelehnt mit den Worten „zu teuer“. Und dann wird mal eben Geld verbrannt für ein paar witzige Spots. Die gigantische Summe von 7 Millionen Euro hätte man durchaus gerne in die Aufstockung von Personal investieren können. Gerade in den Abendstunden wäre mehr Sicherheitspersonal wünschenswert.
Was die Sicherheit stärken würde, wäre definitiv mehr Präsenz von Bundespolizei und der DB-Sicherheit. Und man sollte generell mal das Konzept überdenken, wie man die Sicherheit gewährleisten will. Wenn Konfliktpersonen, welche durchaus schon vor der Zugfahrt auffällig sind, es bis in meinen Zug schaffen, dann haben die aktuellen Mechanismen versagt.
Bahnpersonal hält als Blitzableiter her
Report24: Menschen, die von A nach B kommen müssen und dank der Unzuverlässigkeit der Bahn zu spät oder gar nicht ans Ziel gelangen, können über die sündhaft teuren Werbespots wahrscheinlich kaum lachen. Müsst ihr als Zugbegleiter oft als Sündenböcke und Blitzableiter für aufgestauten Frust herhalten?
Rocco: Ja, wir sind meist dem Frust der Fahrgäste ausgeliefert. Auch dem geschuldet, dass wir in der Regel die ersten Ansprechpartner der Gäste sind. Ich kann den Frust verstehen, ich nutze selbst die öffentlichen Verkehrsmittel. Dennoch würde mir nicht einfallen, das Personal zu beschimpfen und zu beleidigen. Das Personal an der Basis ist das letzte Glied in der Kette, und kann am wenigsten für die Missstände.
Report24: Die Menschen machen so natürlich nur denen das Leben schwer, die gar nichts für die Zustände können – ihr leidet ja selbst unter Verspätungen und Ausfällen und schlagt euch die Stunden wegen liegengebliebener Züge um die Ohren. Was würdest du all den gefrusteten Reisenden und Bahn-Enttäuschten gern mit auf den Weg geben?
Rocco: Bleibt freundlich und respektvoll zueinander und zu uns. Wir sind für euch da. Ich kann da wirklich mit Überzeugung behaupten, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen die Tätigkeit mit Herz und Leidenschaft ausüben. Wir geben täglich unser Bestes, um mit den wenigen Mitteln, die wir haben, das Beste für unsere Gäste rauszuholen. Das funktioniert leider nicht immer. Auch mich ärgert es, wenn wir bei Verspätung die Anschlusszüge vormelden, und dann am Ende doch nur die Mitteilung der Leitstelle kommt, „Zug wartet nicht“. Was mich am meisten ärgert, ist, dass man den Gästen schnell und zuverlässig Informationen geben möchte, und selbst dann fast immer der Letzte ist, der Informationen bekommt.
Verrohung: Schlechtere Lebensqualität und eine realitätsferne Politik
Report24: Auch die Politik beklagt inzwischen verstärkt eine Verrohung der Gesellschaft: Im Fokus der Debatte steht oft der „Hass im Netz“. Manche Politiker betrachten sich wegen Beleidigungen in den sozialen Netzen auch selbst als besonders schwer betroffene Opfer. Siehst du in einer stärkeren Regulierung von Social Media eine Lösung oder siehst du andere Ursachen für die zunehmenden Aggressionen in der Gesellschaft?
Rocco: Eine Regulierung von Social Media kann eine Säule von vielen sein. Gewaltvideos müssen definitiv schneller und konsequenter entfernt werden. Die freie Meinungsäußerung darf dabei aber nicht eingeschränkt werden. Ich sehe auch den schwindenen Wohlstand in unserer Gesellschaft als zentrale Ursache. Aus der Politik wird ja der so oft beschworene Wohlstand immer ganz oben aufgeführt. Allerdings sehe ich da eine Verschlechterung der Lebensqualität. Klar, wenn man, wie die Politiker, uns Deutsche mit ärmeren Ländern vergleicht, dann geht’s uns besser. Ich vergleiche aber gerne den Stand heute mit der Vergangenheit. Vor 30 Jahren war es deutlich leichter für die Bürgerinnen und Bürger, sich ein Haus zu kaufen. Heutzutage sind viele froh, wenn sie gerade so ihre Miete stemmen können. Alles wird teurer. Die Beiträge in den Sozialversicherungen steigen stetig, Lebensmittel im Supermarkt werden immer mehr zum Luxusgut, die Mieten schießen durch die Decke. Dazu kommt die allgemeine schlechte globale Situation, die die Menschen zusätzlich belastet. Diese Mischung wirkt meiner Meinung nach wie ein Brandbeschleuniger und sorgt für mehr Aggressivität in unserer Gesellschaft.
Report24: Hast du das Gefühl, dass die Politik die Probleme, mit denen ihr (und alle, die die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen) konfrontiert seid, versteht und ernst nimmt?
Rocco: Ich denke eher, „die da oben“ sind ganz weit weg von der Realität. Die werden teilweise nicht mal wissen, was sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln abspielt. Woher auch? Die werden doch mit ihrer gepanzerten Dienstlimousine in ihre schicke Stadtrandvilla gefahren, und leben dort bestimmt ganz gut.
Volles Engagement für die Fahrgäste
Report24: Zum Abschluss: Gibt es auch positive Erlebnisse, die deinen Berufsalltag erhellen? Machst du deinen Job immer noch gern?
Rocco: Ja, es gibt auch viele schöne Momente. Ich hatte mal eine ältere Dame im Zug, die wollte über Hamburg an die Küste und dann mit dem Schiff weiter nach Norderney. Bei der Fahrscheinkontrolle hatte ich dann gesehen, dass sie im völlig falschen Zug saß. Sie war daraufhin sehr aufgelöst und weinte. Ich tröstete sie, nahm sie in den Arm und sagte, „wir bekommen das hin“. Als Erstes suchte ich die schnellste Fahrverbindung für sie heraus. Dann fragte ich, ob sie Reiseunterlagen dabei hat. Ich habe dann den Reiseleiter angerufen und mitgeteilt, dass einer seiner Gäste gerade im falschen Zug unterwegs ist und wie die neue Reiseroute für sie aussieht. Mit der neuen Verbindung war dann sogar noch das Schiff erreichbar. Auf meine Anmerkung hin, dass sie ziemlich aufgelöst ist, hat der Reiseleiter jemanden organisiert, der die Dame in Hamburg in Empfang nimmt und mit dem nächsten Zug bis an die Küste begleitet. Am nächsten Umsteigebahnhof, wo sie meinen Zug dann verlassen musste, habe ich sie noch zur Tür begleitet mit den Worten „Wenn ich könnte, würde ich Sie bis zu Ihrem nächsten Zug bringen, aber ich kann hier nicht einfach absteigen“.
Ein aufmerksamer Fahrgast hat das mitbekommen und sagte, er bringt sie rüber, er muss denselben Zug nehmen. Er bekam auch mit, wie ich für sie alles umorganisiert hatte, und beide bedankten sich dafür. Das war für mich ein schöner Moment und ich war dabei richtig glücklich, weil ich wusste, die Dame bekommt ihr Schiff und kann wie geplant ihren Urlaub antreten. Das sind die Momente, wo ich mir denke: „Hier bin ich richtig, das ist genau mein Ding.“
Aber es kam noch besser. Zwei Wochen später klingelte mein Diensthandy mit einer fremden Nummer. Es war wieder die ältere Dame. Sie hatte sich die Mühe gemacht, meine Nummer rauszubekommen, um sich persönlich zu bedanken. Sie erzählte, dass es in Hamburg reibungslos funktionierte und die Begleitung sie dann mit dem Zug bis zum Schiff brachte. Problem war nur, der Zug hatte dann Verspätung und das Schiff auf die Insel war weg. Es war das letzte des Tages. Sie berichtete, dass das Reiseunternehmen ihr kurzfristig einen Flug auf die Insel organisierte. Sie war noch am selben Abend dort und sagte, das war der schönste Urlaub, den sie je hatte, und sie wird nie vergessen, wie freundlich und hilfsbereit ich war. Das war unendlich schön und hat mich so berührt, dass dann ich derjenige war, der Tränen in den Augen hatte, aber vor Freude. Kurz gesagt: Ja, ich mache meinen Job nach wie vor gerne.
Report24: Herzlichen Dank für das Gespräch und eine konfliktfreie nächste Schicht – danke für deine Arbeit!
Rocco: Dankeschön, gerne. Und vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mich zu äußern.
Douglas Macgregor: Ein potenzieller US Iran Krieg könnte außer Kontrolle geraten
In einem kürzlich geführten Interview mit Richter Andrew Napolitano auf dem Kanal „Judging Freedom“ warnt Colonel Douglas Macgregor, ein ehemaliger US Militärexperte, vor den Risiken eines Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Macgregor betont, dass ein solcher Krieg unvorhersehbare Konsequenzen haben könnte, einschließlich regionaler Eskalation und globaler wirtschaftlicher Auswirkungen. Das Gespräch, das am 10. Februar 2026 stattfand, berührt auch Themen wie die Taiwan Frage, die Ukraine und den bevorstehenden Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu bei Präsident Donald Trump.
Grundsatzkritik an US Militärinterventionen
Unerklärte Kriege sind in der modernen Geschichte alltäglich geworden, und tragischerweise engagiert sich die US Regierung oft in präventiven Kriegen, die nichts anderes als Aggression darstellen, ohne dass die amerikanische Öffentlichkeit dagegen protestiert. Die Gesellschaft hat sich an den illegitimen Einsatz von Gewalt durch die Regierung gewöhnt. Um eine wirklich freie Gesellschaft zu schaffen, muss das Prinzip der Einleitung von Gewalt verstanden und abgelehnt werden.
Macgregor zitiert historische Denker wie Thomas Jefferson und stellt provokative Fragen: Was, wenn man manchmal das Land lieben muss, indem man die Regierung verändert oder abschafft? Was, wenn die beste Regierung die ist, die am wenigsten regiert? Und was, wenn die größte Gefahr für die Freiheit gerade jetzt besteht?
China und Taiwan
Bevor Macgregor auf das Hauptthema eingeht, wirft er einen Blick auf aktuelle Entwicklungen bezüglich China. Taiwan hat angekündigt, dass es 40 Prozent seiner Mikrochip Produktion nicht in die USA verlegen wird, wie zuvor vereinbart. Dies macht eine geplante Investition von 250 Milliarden Dollar zunichte. Gleichzeitig unterstützt das chinesische Festland pro Wiedervereinigungs Kräfte in Taiwan, insbesondere die Kuomintang Partei KMT, die aus der Zeit Chiang Kai sheks stammt.
Die KMT dominiert derzeit das taiwanesische Parlament und setzt sich für eine friedliche Wiedervereinigung mit dem Festland ein, ähnlich dem Modell von Hongkong. Wenige Amerikaner wissen, dass es in Taiwan keinen starken Drang zur Unabhängigkeit gibt; stattdessen blockiert das Parlament pro unabhängige Maßnahmen des Präsidenten.
Macgregor erklärt, dass China hier die besseren Karten hat. Peking möchte keinen Krieg um Taiwan, sondern eine friedliche Einigung. Sollte es jedoch zu einem Konflikt kommen, würde die USA wahrscheinlich die TSMC Fabrik, das weltweit führende Zentrum für Mikrochip Produktion, zerstören, um zu verhindern, dass China sie übernimmt.
TSMC wurde von Morris Chang gegründet, einem ehemaligen Mitarbeiter von Texas Instruments, und ist für seine hochkomplexen Halbleiter bekannt. Die Pläne, Produktion in die USA zu verlegen, scheitern unter anderem an Standortproblemen. Die Fabrik soll in der Arizona Wüste gebaut werden, wo Wasserknappheit und Mangel an qualifizierten Arbeitskräften ein Hindernis darstellen. Historisch gesehen ist Taiwan Teil Chinas, wie es die USA seit dem Shanghai Kommuniqué von 1972 anerkennen. Macgregor plädiert dafür, die Wiedervereinigung nicht zu behindern, da Taiwan nur kurzzeitig unter japanischer Herrschaft stand.
Die Ukraine
Ein weiterer Aspekt des Interviews betrifft die Ukraine. Macgregor sieht Anzeichen für eine große russische Frühjahrsoffensive im Osten und Süden des Landes. Russland bereitet sich darauf vor, Gebiete wie Odessa und Charkiw, historisch russischsprachig, zu erobern, die es von Anfang an beansprucht hat.
Eine Offensive auf Kiew ist möglich, da die ukrainischen Streitkräfte geschwächt sind, doch Russland wolle kein ganzes Ukraine beherrschen, sondern es eher wie ein neutrales Österreich gestalten. Das Ziel sei die Integration von Noworossija Neurussland, wie es Katharina die Große im 18. Jahrhundert gründete, ohne über Ukrainer zu herrschen.
Netanyahu, Trump und der Iran
Der Kern des Gesprächs dreht sich um den bevorstehenden Besuch Netanyahus bei Trump im Weißen Haus. Macgregor erwartet Diskussionen über eine Koordination gegen den Iran, inklusive Lastenteilung. Wie viel übernehmen die USA, wie viel Israel?
Israel hat unvollendete Ziele in Gaza und könnte einen Iran Krieg nutzen, um dort weiter vorzugehen, Palästinenser zu vertreiben oder anzugreifen sowie Ziele in Libanon und Syrien zu treffen. Die USA fordern drei Bedingungen vom Iran, die unrealistisch sind: keine Unterstützung für Milizen, keine Angriffe auf Israel und keine nukleare Aufrüstung.
Tatsächlich gehe es um die Zerstörung des iranischen Staates einschließlich Regimewechsel durch Angriffe auf Infrastruktur wie Wasser, Energie, Häfen und Nahrung. Macgregor warnt vor unvorhersehbarer Dauer. Ähnlich wie der Kosovo Krieg 78 Tage dauerte, könnte dies eskalieren, ohne schnelle Erfolge.
Regionale und globale Eskalation
Sollte der Konflikt länger als zwei Wochen dauern, würde die regionale Lage explodieren. Iran würde gegen Israel und US Truppen in der Region kontern. Länder wie Saudi Arabien, die Emirate, Qatar, Kuwait, Ägypten und Jordanien würden protestieren, da es ihre Wirtschaft schädigt.
Die Türkei lehnt trotz Differenzen mit Iran eine Zerstörung ab und könnte intervenieren, wenn Russland und China mitziehen. Die türkische Bevölkerung ist anti israelisch, und die Armee könnte Israel stärker bedrohen als Iran.
Macgregor betont die Gefahr einer Eskalation. Russland und China haben ein Interesse am Überleben Irans und könnten eingreifen, wenn es zerstört wird. Russland ist frustriert von US Verhandlungen und sieht sie als nutzlos. China, abhängig von iranischem Öl, könnte U Boote einsetzen, gegen die keine Marine vorbereitet ist. Der Preis für Benzin in den USA könnte bei Schließung der Straße von Hormus explodieren, über 100 Dollar pro Barrel. Zudem kontrolliert China 90 Prozent der Raffination seltener Erden, essenziell für US Verteidigung, ein weiterer Schwachpunkt.
Militärische Grenzen der USA
Warum stoppte Netanyahu vor einem Monat einen geplanten iranischen Angriff? Macgregor meint, es fehlte an US Schiffen in der Region, und der Mossad setzte auf innere Unruhen in Iran, die scheiterten. Trotz Behauptungen von Schwäche ist Iran stärker als je zuvor mit fortschrittlichen ballistischen und hypersonischen Raketen.
Die USA sind militärisch begrenzt. Die Navy hat Munitionsvorräte für nur 10 bis 14 Tage, keine Surge Kapazität wie im Zweiten Weltkrieg. Die Air Force könnte intensiv für vier bis fünf Tage bomben, doch iranische Luftabwehr russischer und chinesischer Herkunft könnte Stealth Flugzeuge erfassen.
Netanyahu würde einen nuklearen Deal mit Iran ablehnen, da er auch das Raketenarsenal fürchtet. Macgregor zitiert einen deutschen Analysten: Nuklearmächte sind souverän, andere nicht. Ein Krieg würde Proliferation fördern. Israel hat Atomwaffen ohne den Nichtverbreitungsvertrag zu unterzeichnen, während Iran ihn respektiert. Dies schafft Ungleichheit, gerechtfertigt durch Israels Holocaust Geschichte und Lobby Einfluss in den USA.
Revolutionstag und historische Vergleiche
Am 11. Februar 2026 feiert Iran den Jahrestag der Revolution von 1979 mit Millionen auf den Straßen. Ein Angriff könnte dadurch verzögert werden. Macgregor vergleicht mit Eisenhower, der den Korea Krieg beendete, und Kennedy, der den Kuba Krise Krieg verhinderte. Trump sollte die Konsequenzen bedenken. Es gebe keine schnelle Lösung, sondern Risiken für Eskalation und langfristige Schäden.
Fazit
Zusammenfassend mahnt Macgregor zur Vorsicht. Ein US Iran Krieg könnte nicht nur den Nahen Osten destabilisieren, sondern globale Mächte wie Russland und China einbeziehen, mit katastrophalen wirtschaftlichen und militärischen Folgen. Statt Aggression plädiert er für Diplomatie und Realismus.
Eine von den USA geführte Regimewechsel-Operation im Iran käme einer Kriegserklärung an China gleich – und hier ist der Grund
China bezieht fast 20 Prozent seines Öls aus dem Iran, und US-Drohungen mit militärischen Maßnahmen gegen den Iran haben China gerade dazu veranlasst, seine Banken anzuweisen, US-Staatsanleihen abzustoßen – ein weiterer Schlag gegen den Dollar.
Leo Hohmann
Die sich verdichtenden Gerüchte über einen militärischen Zusammenstoß zwischen den USA/Israel und dem Iran sind nicht über Nacht entstanden. Sie sind das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung, die direkt nach der Islamischen Revolution und der iranischen Geiselkrise begann, als der damalige Präsident Jimmy Carter die ersten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängte.
Washington nutzte in den 1980er-Jahren den Irak als Stellvertreter, um gegen die Iraner zu kämpfen – im blutigen Iran-Irak-Krieg, in dem Saddam Hussein, damals ein Verbündeter der USA, Senfgas einsetzte, um Zehntausende Iraner zu töten.
Da Israel von vielen in der Region als feindlicher US-/britischer Vorposten im Nahen Osten gesehen wird, schlug der Iran zurück, indem er Israel über seinen Hisbollah-Stellvertreter im Libanon und in Syrien bekämpfte.
Die Israelis reagierten nach dem Massaker vom 7. Oktober, das sie dem Iran anlasten, indem sie halfen, einen Putsch in Syrien zu inszenieren, und anschließend Hisbollah-Kommandeure durch militärische und geheimdienstliche Operationen ausschalteten – einschließlich explodierender Pager. Israel ermordete außerdem iranische Kommandeure im Juni 2024 während des 12-tägigen Krieges. Trump selbst ordnete am 3. Januar 2020 die Tötung des iranischen Generals Qasem Soleimani in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad an.
Doch nun scheint diese gesamte Dynamik auf einen Höhepunkt zuzusteuern – mit der realen Möglichkeit eines umfassenden Krieges zwischen den USA und dem Iran.
Das Entscheidende ist: Dies ist weniger ein Krieg gegen den Iran als vielmehr ein Versuch, den Druck auf China und Russland weiter zu erhöhen.
Wie zuvor im Fall Venezuelas, bevor die USA dieses Land angriffen und dessen Staatschef entführten, stellt auch der Iran eine zentrale Ölquelle für China dar.
Während China jedoch nur etwa 5 Prozent seines gesamten Ölbedarfs aus Venezuela bezog, erhält es 19,8 Prozent aus dem Iran.
China könnte es sich leisten, auf venezolanisches Öl zu verzichten.
China kann es sich jedoch nicht leisten, sowohl venezolanisches als auch iranisches Öl zu verlieren.
Indem Washington Chinas Zugang zu billigem Öl von seinen Verbündeten kappt, hofft es, China dazu zu zwingen, Öl von Washington selbst oder von mit Washington verbündeten Ländern zu kaufen – zu deutlich höheren Preisen. So sparen chinesische Raffinerien laut Berechnungen eines von Reuters zitierten Händlers etwa 8 bis 10 Dollar pro Barrel, wenn sie iranisches leichtes Rohöl statt nicht sanktioniertes omanisches Rohöl kaufen.
China verfügt über die größte industrielle Basis der Welt und ist daher in hohem Maße auf riesige Energiemengen angewiesen, um diese Industrie zu betreiben. Nimmt man 25 Prozent davon weg, gerät Chinas industrielle Wirtschaft ernsthaft in Gefahr.
Leos Newsletter ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Beiträge zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, erwägen Sie, kostenloser oder zahlender Abonnent zu werden.
Wir wissen, dass die meisten Kriege um Ressourcen geführt werden, und dieser ist keine Ausnahme. All das Gerede über iranische Terrorfinanzierung und die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung ist lediglich ein Vorwand, um in Amerika und im Westen Kriegshysterie unter den unwissenden Massen zu schüren. Washington liebt Terrorismus, wenn er in seinem Auftrag ausgeübt wird. Deshalb kommen die Ukrainer mit der Ermordung russischer Generäle ohne jeden Protest aus Washington davon, und die Israelis können in jedes beliebige Land einmarschieren und die führenden Köpfe ihrer Gegner ermorden. Würden Russland, China oder der Iran dasselbe tun, würde es als Terrorismus bezeichnet.
Internationale Geopolitik ist gnadenlos und hinterhältig und wird ohne jede Rücksicht auf menschliches Leben oder grundlegende Moral betrieben. Es geht ausschließlich um Machtausübung und die Aneignung von Ressourcen.
Wenn China Washingtons Vorgehen gegen den Iran als einen verdeckten Versuch sieht, seiner treibstoffabhängigen Industriebasis die notwendigen Energieressourcen zu entziehen, dürfte dies in Peking als eine US-Kriegserklärung interpretiert werden.
Washington riskiert die sehr reale Möglichkeit, dass China es nicht länger in seinem Interesse sieht, angesichts zunehmender US-Aggression gegen seine Verbündeten weiter zurückhaltend zu bleiben. China konnte es sich leisten, Venezuela aufzugeben – aber kann es sich leisten, die Beziehungen zum Iran abzubrechen?
Die Frage, die in Trumps Kopf kreisen muss, lautet: Wollen wir wirklich Chinas Ölversorgung abwürgen und den Drachen noch weiter in die Arme des russischen Bären treiben?
Russland ist bereits durch die Ukraine gebunden – einen Krieg, der in wenigen Wochen beendet gewesen wäre, wenn nicht die USA und die NATO massive Mengen an Waffen und Geld in die Ukraine gepumpt hätten. Die USA sanktionieren Länder, die russisches Öl kaufen, und nun scheint es, als wollten sie sich auch das Öl vornehmen, das vom Iran nach China fließt.
Washington hat Russland bereits in die Enge getrieben. Ist China das nächste Ziel?
China mangelt es keineswegs an Hebelwirkung gegenüber den USA. Es verfügt über nicht-militärische Optionen, um dem Westen zu begegnen, und wird diese wahrscheinlich nutzen, bevor es militärisch handelt. China könnte die Lieferung seltener Erden an die USA einstellen. Es könnte die Verarbeitung lebenswichtiger Medikamente wie Antibiotika stoppen, von denen der Großteil aus China in die USA kommt.
China kann sein Spiel im Bereich der wirtschaftlichen Kriegsführung intensivieren – und es gibt Anzeichen dafür, dass genau das geschieht.
In einem jüngsten Schockschritt hat Xi angeordnet, dass chinesische Banken US-Staatsanleihen abstoßen. Große chinesische Banken haben dies bereits stillschweigend getan, doch nun soll die Ent-Dollarisierung offiziell und in großem Stil erfolgen. Das ist auch der Grund, warum China in einem beispiellosen Ausmaß Gold kauft.
Die USA wiederum versuchen, den Verlust von Chinas Bereitschaft zur Finanzierung der US-Schulden auszugleichen, indem sie Geld drucken, um ihre eigenen Schulden zu kaufen. Das ist so, als würde man seine eigenen Dollars mit einem Tintenstrahldrucker drucken, um die Kreditkartenschulden zu begleichen.
Das Ergebnis dieser irrsinnigen Geldpolitik wird eine steigende Inflation sein. Amerikaner, die bereits Mühe haben, Lebensmittel, Autoreparaturen, steigende Versicherungsprämien und vieles mehr zu bezahlen, werden noch stärkeren inflationären wirtschaftlichen Druck erleben – dank Donald Trumps rücksichtsloser Außenpolitik. Dieses Phänomen könnte zu keinem schlechteren Zeitpunkt auftreten, da wir uns den Zwischenwahlen im November nähern.
Unterm Strich geht es um Folgendes: Es tobt ein großer Kampf um die globale Währungsvorherrschaft und ein Wettlauf darum, wer die meisten Gold-, Mineral- und Ölressourcen kontrolliert.
Die USA haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs großen Wohlstand erlangt, weil der Dollar als Weltreservewährung diente. Doch die USA haben dieses Privileg missbraucht, indem sie ihre Währung als Waffe eingesetzt und Sanktionen gegen Länder verhängt haben, die Washingtons Politik im Nahen Osten und anderswo nicht folgten. Infolgedessen rennen nun nach Jahrzehnten der Beobachtung, wie die USA Länder bestrafen, die lediglich souverän Handel treiben wollen, viele Staaten zur Tür hinaus. Sie stoßen ihre Dollars ab und kaufen keine US-Staatsanleihen mehr. Sie haben gesehen, was mit Russland geschehen ist, und nun mit China, und fürchten, dass sie die Nächsten sein könnten.
Die jahrelange Feindschaft zwischen dem Iran und den USA/Israel bildet den Kontext, der in den Mainstream-Medien in der Regel nicht behandelt wird. Diese Medien wollen glauben machen, ein möglicher Krieg gehe darum, das unterdrückte iranische Volk zu befreien – in Wirklichkeit geht es um das Neuzeichnen von Karten und die erzwungene Neuordnung von Nationen zugunsten der USA und Israels, mit dem Risiko, dass China und Russland in eine regionale oder sogar globale militärische Konfrontation hineingezogen werden.
Manche würden sagen, dass die USA vor einer Abrechnung stehen, dass ihr Einfluss im Nahen Osten und weltweit nicht mehr im Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen und militärischen Stärke steht und dass ihre Macht eher auf Wahrnehmung als auf Realität beruht.
Könnte es 2026 zu einer solchen Abrechnung kommen, mit dem Iran als dem Ort, an dem die USA zu weit gegangen sind – nicht nur gegenüber dem Iran, sondern auch gegenüber China?
Nur die Zeit wird es zeigen.
Anders als im 12-tägigen Krieg im vergangenen Juni wurde das Ziel dieses nächsten militärischen Angriffs offen als „Regimewechsel“ benannt.
Doch genau darin liegt das Problem.
Das iranische Regime wird nicht einfach seine Koffer packen und gehen, sobald die ersten Bomben auf Teheran fallen.
Es wird sich eingraben und die Bombardements aussitzen.
Der einzige Weg, einen schnellen Regimewechsel zu erzwingen, wäre der massive Einsatz von Bodentruppen – etwas, wozu Trump offenbar nicht bereit ist, angesichts der Wahrscheinlichkeit inakzeptabler US-Verluste kurz vor einer Wahl.
Einen Regimewechsel allein durch Bombardierungen ohne Bodentruppen zu erzwingen, würde Monate ununterbrochener Luftangriffe erfordern.
Militärstrategen wie Oberst Douglas MacGregor warnen seit Langem, dass die USA weder über die Munitionsvorräte noch über die industrielle Kapazität verfügen, um eine monatelange Bombenkampagne gegen den Iran durchzuführen.
Trump hat sich damit selbst in eine Ecke manövriert. Er hat eine massive Marinearmada in der Region des Persischen Golfs zusammengezogen – ausschließlich mit dem Ziel, den Iran anzugreifen und dessen Regime auszutauschen.
Möglicherweise bevorzugt er einen ausgehandelten „Deal“, der es dem iranischen Regime erlaubt, an der Macht zu bleiben, im Austausch gegen bestimmte Zugeständnisse hinsichtlich der Unterstützung anti-israelischer Stellvertreter und des Vorgehens gegen Proteste im eigenen Land. Doch dann stehen ihm die Israelis gegenüber. Sie sind fest entschlossen, einen Regimewechsel herbeizuführen, und zählen darauf, dass Trump diesen für sie durchsetzt. Auch die Neokonservativen in Washington drängen Trump, den Abzug zu drücken und notfalls eine umfassende Invasion des Iran zu starten, um die islamische Regierung zu stürzen.
Die Welt verändert sich – und leider nicht in einer Weise, die den Interessen der USA dienlich ist. Und es sind Veränderungen, die Washington sich selbst eingebrockt hat.
Pepe Escobar: Iran zwingt US-Marine zum Rückzug, Trump unter Schock, als Russland und BRICS eingreifen
In einem kürzlichen Interview mit dem Journalisten Danny Haiphong analysiert der renommierte Geopolitik-Experte Pepe Escobar die aktuellen Spannungen zwischen Iran und den USA. Escobar, der gerade aus Hongkong zurückgekehrt ist, beleuchtet den Rückzug der US-Marine, die Rolle von China, Russland und den BRICS-Staaten sowie die prekäre Lage von Präsident Donald Trump. Basierend auf diesem Gespräch entsteht ein detaillierter Überblick über die geopolitischen Dynamiken in Westasien und ihre globalen Auswirkungen.
Der Rückzug der US-Marine: Ein Zeichen der Schwäche?
Die Spannungen im Persischen Golf haben in den letzten Monaten eine dramatische Wendung genommen. Die USS Lincoln, das Flaggschiff einer mächtigen US-Armada, hat sich etwa 1400 Kilometer von der iranischen Küste in das Arabische Meer zurückgezogen. Dieser Schritt wird von Pepe Escobar als klares Zeichen interpretiert, dass Iran die Bedingungen diktiert. Nicht nur die US-Navy, sondern auch kommerzielle Schiffe unter US-Flagge wurden angewiesen, sich so weit wie möglich vom Strait of Hormuz fernzuhalten – einer strategisch entscheidenden Meerenge, durch die ein Großteil des globalen Öltransports fließt. Diese Maßnahmen stammen aus einer offiziellen US-Maritime-Advisory und unterstreichen die wachsende Unsicherheit in der Region.
Escobar betont, dass Iran den „Bluff“ von Präsident Trump – den er spöttisch als „Neo Caligula“ bezeichnet – durchschaut hat. Trump stehe nun vor einer unlösbaren Dilemma: Angreifen würde eine massive Vergeltung provozieren, einschließlich des potenziellen Versenkens von US-Flugzeugträgern oder Angriffe auf Tel Aviv. Nichts zu unternehmen, würde jedoch seine Drohungen als leer entlarven und seine Position im Globalen Süden schwächen. Die Iraner haben wiederholt signalisiert, dass sie auf jede Aggression mit voller Härte reagieren würden, was die USA in eine Position „zwischen Hammer und Amboss – auf Steroiden“ bringt.
Chinas Solidarität mit Iran: Von Satellitenbildern bis zu Militärmodellen
Ein weiterer Aspekt, der die multipolare Weltordnung unterstreicht, ist die wachsende Unterstützung Chinas für Iran. Escobar hebt hervor, wie der chinesische Militärbotschafter der iranischen Luftwaffe ein Modell des J-20-Stealth-Kampfjets überreichte – ein Akt, der auf Social Media verspottet wurde, aber tiefergehende Kooperation andeutet. Chinesische Satellitenbilder haben öffentlich sensible Informationen über US-THAAD-Raketenabwehrsysteme preisgegeben, die als „freie Zielkoordinaten“ für Iran dienen könnten. Dies sei ein klares Signal der Solidarität.
China sieht Iran als zentralen Partner im Belt-and-Road-Initiative (BRI), insbesondere als Transitkorridor von Ost nach West über Zentralasien. Die umfassende strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern umfasst militärische Austausche auf höchster Ebene, einschließlich Elektroniksysteme und Gegenintelligenz. Escobar merkt an, dass chinesische Akademiker Trumps Bluff offen kritisieren, während die offizielle Position Pekings – ein Schweigen, das Bände spricht – auf nationale Sicherheitsinteressen hinweist. Sollte Iran fallen, wären Russland und China die nächsten Ziele, was die Notwendigkeit einer engen Allianz unterstreicht.
Russlands Rolle: Militärhilfe und BRICS-Agenda
Ähnlich engagiert ist Russland. Escobar erwähnt tägliche Landungen russischer IL-76-Transportflugzeuge in Iran, deren Ladung – militärische Geheimnisse – unbekannt bleibt, aber Teil einer strategischen Partnerschaft ist. Russland und China bieten Iran alles Nötige, von Satellitendaten bis zu fortschrittlicher Technologie, um gegen US-Drohungen standzuhalten.
Auf breiterer Ebene beschleunigt Russland die BRICS-Agenda. Außenminister Sergej Lawrow und sein Stellvertreter Sergej Rjabkow haben in jüngsten Interviews klare Worte gefunden: Die USA praktizieren „reinen Bidenismus“ durch Sanktionen und einseitige Forderungen, was die Beziehungen vergiftet. BRICS konzentriere sich auf die Integration neuer Mitglieder (nun 10 Staaten plus 10 Partner) und die Schaffung widerstandsfähiger Finanzmechanismen gegen externe Druck. Rjabkow betont Fortschritte bei Zahlungssystemen in nationalen Währungen und einer einheitlichen Stimme zu internationalen Krisen – von Venezuela bis zum Nahen Osten.
Lawrow geht weiter: BRICS und der Shanghai Cooperation Organization (SCO) zielen auf eine Architektur ab, die immun gegen „illegale Aktionen des Westens“ ist. Dies sei ein Manifest für die multipolare Welt, koordiniert von Russland und China. Escobar sieht hier eine organische Allianz zwischen Russland, Indien, China und potenziell Iran (RIIC), die auf Trumps Drohungen reagiert.
Die Regionalen und Globalen Implikationen: Ein Krieg für den Globalen Süden?
Escobar warnt, dass ein Angriff auf Iran nicht auf Westasien beschränkt bliebe, sondern den gesamten Globalen Süden betreffen würde. Yemen, Hisbollah und irakische Milizen würden involviert, wie Iran versprochen hat. Die jüngste Treffen zwischen dem iranischen Außenminister Araghchi und dem jemenitischen Gesandten in Muskat unterstreichen diese Einheit. Der Globale Süden beobachtet genau: Irans Souveränität lehrt Lektionen über Widerstand gegen Hegemonie.
Wirtschaftlich eskaliert die Dedollarisierung. Russland überholt Saudi-Arabien als Chinas größter Öllieferant, während China seinen Handel mit Iran ausbaut. Saudi-Arabien, in einer heiklen Position, plädiert für Diplomatie, da ein Konflikt den Persischen Golf zerstören würde. Escobar betont, dass der Strait of Hormuz nur im Extremfall geschlossen würde – nach Rücksprache mit China und Russland –, was zu Ölpreisen von bis zu 700 Dollar pro Barrel und einem Kollaps des Derivatemarkts führen könnte.
Trumps Dilemma: Von Netanyahu bis Bad Bunny
Trump, gefangen in seiner Unsicherheit, trifft Netanyahu, der ein „Triad“ von Forderungen stellt: Keine Urananreicherung, keine Unterstützung für „Proxies“ und ein minimales Raketenprogramm. Verhandlungen in Oman (nicht Istanbul, da Iran Erdogan misstraut) drehen sich um begrenzte Anreicherung (bis 60 %), aber Iran lehnt Sanktionsaufhebung ab – ein No-Go für die USA.
Escobar kritisiert Trumps fehlende Strategie: Entscheidungen basieren auf Launen, Fox News oder Einflüssen wie Netanyahus. Die US-Militärindustrie ignoriere die strategischen Allianzen Irans. Domestisch sinken Trumps Umfragewerte auf 37-44 %, verschärft durch Skandale wie „Bad Bunny“. Dies zerstöre MAGA und mache Trump zu einem „Lame Duck“.
Der Moralische Verfall des Westens und die Multipolarität
Escobar sieht einen tieferen Kontext: Den totalen Nihilismus des Westens, symbolisiert durch den Gaza-Genozid, Epstein-Skandale und den Zusammenbruch der „regelbasierten Ordnung“. Eliten wie der ehemalige Bank-of-England-Chef geben zu, das System manipuliert zu haben. BRICS biete eine Alternative: Souveränität und Kooperation.
Escobars Reisen: Ein Blick in die Zukunft der Seidenstraßen
Abschließend teilt Escobar Eindrücke aus seinen Reisen. In Chongqing, dem „Ground Zero“ der Neuen Seidenstraßen, sah er den Logistikpark, wo Frachtzüge nach Europa starten. Das Akronym „Yuxinou“ (Chongqing-Xinjiang-Europa) symbolisiert Konnektivität. Trotz Sanktionen wachsen Korridore, und Firmen wie Porsche und Audi produzieren dort. China repräsentiere Fortschritt, Kreativität und Frieden – ein Kontrast zu westlichem Chaos.
Insgesamt malt Escobar ein Bild einer Welt im Wandel: Iran, unterstützt von Russland und China, widersteht US-Druck, während BRICS die multipolare Ordnung festigt. Die Frage bleibt, ob Trump den Konflikt eskaliert oder zurückweicht – mit globalen Konsequenzen.
Neue Videos am Mittwoch
Die Welt dreht sich – wir liefern den Kontext.
Unsere aktuellen Videos zeigen, worauf es ankommt: Relevante Themen, präzise Analysen und journalistische Tiefe ohne Spektakel. Vom Brennpunkt der Weltpolitik bis zum Umbruch in der Nachbarschaft – wir bieten die Informationen, die wirklich zählen. Kein Alarmismus, keine leeren Schlagzeilen – nur das, was euch weiterbringt. Für alle, die mitdenken, hinterfragen und mehr wollen. Jetzt ansehen, dranbleiben und mitreden – denn Aufklärung ist der Anfang von Veränderung.
Warum töten wir 99 % gesunde Zellen, um 1 % Krebszellen zu bekämpfen?
Lawrow attackiert Trump und die USA: Trump macht die selbe Politik wie Biden
Warum Millionen auch heute noch für Diktatoren stimmen würden (Philosophy Coded – Deutsch)
DAS DIGITALE DILEMMA – ein Film von Klaus Scheidsteger
Unterricht unter Bomben: So sieht Schule in Gaza wirklich aus
Die achte Front – Israels Krieg gegen die Realität
Ideologie ersetzt Heimat – Kayvan Soufi-Siavash über Macht, Medien und Wirklichkeit
Michael Hudson: Das Schicksal der Zivilisation – Finanzwahn & Zusammenbruch
Großbritannien: Grüner Lockdown light wird Realität– von Norbert Häring
Die Epstein E Mails enthüllen die 9/11 – Schattenkommissionm | Bowne Report Deutsch
Ideologie statt Heimat – Politik als Nebenbühne
Ideologie statt Heimat – Politik als Nebenbühne von Wissensgeist.TV
Kayvan Soufi-Siavash über Abhängigkeit, Macht und die Verengung des Denkens
FBI-Fotos aus Jeffrey Epsteins Villa – was die Mächtigen dort gesehen haben müssen
Andrei Martyanov: Warum ein Krieg gegen Iran zum Verlustgeschäft wird
Schlafexperte: Nachts nicht urinieren und warum Sex nachts keine gute Idee ist
Die Zersetzung der Gesellschaft – KGB Überläufer erklärt den strukturierten ideologischen Umsturz
Für immer 18: Diese 4 Stoffe sind jetzt wichtig ab 40
Wie Epstein vom Mossad, der CIA und dem MI6 benutzt wurde – John Kiriakou, ehemaliger Whistleblower
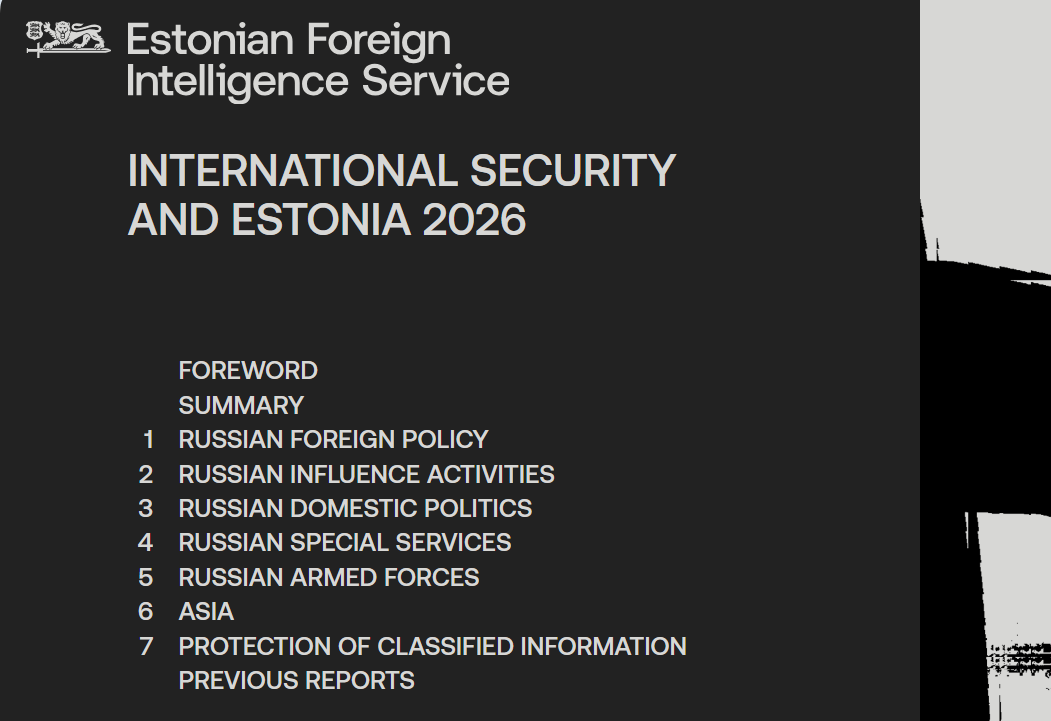
Estlands Geheimdienst gegen NATO-Angst: Kein russischer Angriff geplant
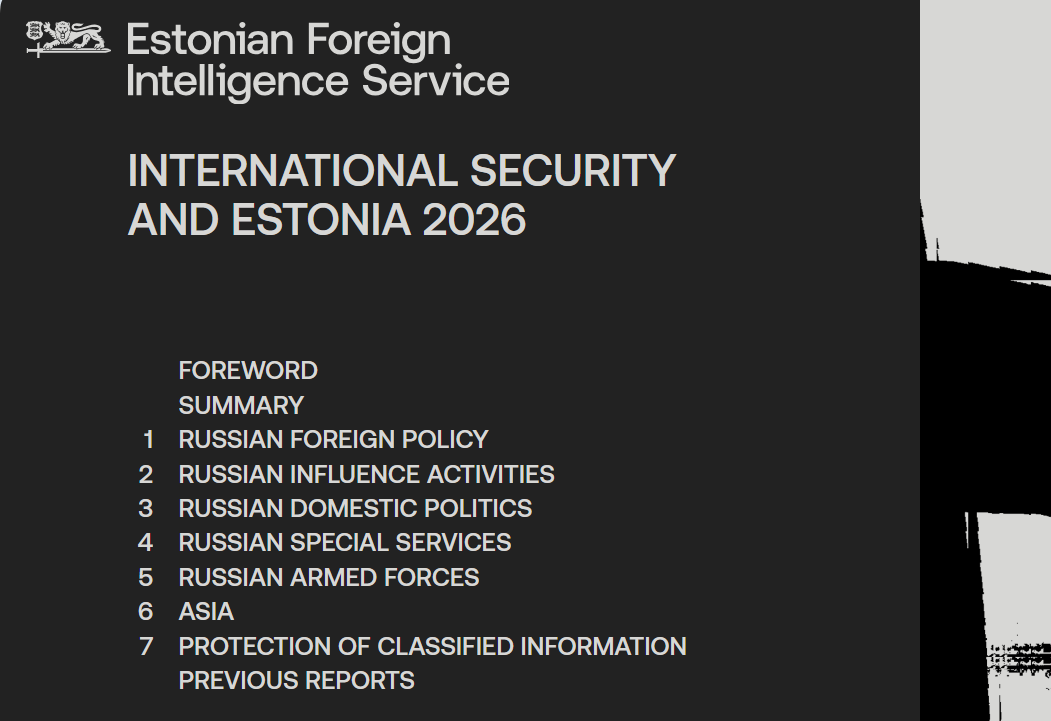
Im jährlichen Bericht des estnischen Auslandsgeheimdienstes hält die Behörde nüchtern fest: Russland hat keine Absicht, das Land anzugreifen. Das Baltikum – Estland, Lettland, Litauen – gilt üblicherweise als rhetorischer Scharfmacher im Konflikt der EU mit Russland und dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Estland hat durch die Person Kaja Kallas, inoffizielle „Außenministerin“ der EU, eine besonders […]
Der Beitrag Estlands Geheimdienst gegen NATO-Angst: Kein russischer Angriff geplant erschien zuerst unter tkp.at.

Blackout in Spanien – Macron kritisiert Abhängigkeit von Solar und Wind

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den großen Stromausfall, der die Iberische Halbinsel im April 2025 heimgesucht hat, auf die starke Abhängigkeit Spaniens von Solar- und Windenergie zurückgeführt und nicht auf unzureichende grenzüberschreitende Stromverbindungen mit Frankreich. Bekanntlich hatte zu viel Solarstrom auf der Iberischen Halbinsel zuerst zu einem Blackout in Portugal und danach in Spanien […]
Der Beitrag Blackout in Spanien – Macron kritisiert Abhängigkeit von Solar und Wind erschien zuerst unter tkp.at.

Er hatte bloß um Ruhe gebeten: Migranten schlagen Deutschen zusammen

In Zeiten, in denen öffentliche Räume immer öfter Schauplatz von Eskalationen werden, reicht manchmal ein einziger höflicher Satz – und alles kippt. Am frühen Morgen des 8. Februar 2026 wurde diese bittere Realität am Bahnhof Rosenheim erneut deutlich: Ein 38-jähriger Mann bat drei lautstark sprechende Migranten um etwas mehr Rücksicht – und erntete dafür brutale Schläge ins Gesicht. Die Polizei ließ die Täter prompt wieder frei.
Der Polizei zufolge wurde am Bahnhof Rosenheim am frühen Sonntagmorgen ein 38-jähriger Deutscher von drei Migranten angegriffen und verprügelt. Er hatte in der Bahnhofshalle drei lautstark diskutierende migrantische Männer angesprochen und sie gebeten, ihre Unterhaltung etwas leiser zu führen. Statt einer Entschuldigung kam es zum Streit – und dann zu massiven Schlägen, die von dem Trio ausgingen.
Die alarmierte Bundespolizei fand bei ihrem Eintreffen zwei Personen, die in eine Rangelei verwickelt waren, am Boden vor und trennte die Beteiligten. Zeugen wiesen die Beamten darauf hin, dass ursprünglich drei Männer auf das Opfer eingeprügelt hätten. Die beiden Flüchtigen konnten wenig später von Streifen der Landespolizei festgenommen werden – einer im Umfeld des Bahnhofs und der andere im angrenzenden Stadtgebiet. Der 38-Jährige erlitt durch die Schläge mehrere Platzwunden im Gesicht.
Die Schläger (35, 31, 28) stammen aus dem Jemen, Eritrea und Sierra Leone. Laut Polizei sind sie in der Vergangenheit in Deutschland ausländerbehördlich registriert worden. Ein Alkoholtest ergab bei jedem einen Wert zwischen rund einem und knapp zwei Promille. Gegen die drei Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.
Unfassbar: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie aus dem Gewahrsam entlassen. Sie müssen mit einem Strafverfahren rechnen“, heißt es in der Polizeimeldung. Das brutale Schläger-Trio wurde also wieder auf die Bürger losgelassen. Bis es zu einem Strafverfahren kommt – wenn es überhaupt dazu kommt – können sie längst untergetaucht sein.
Der Vorfall am Rosenheimer Bahnhof ist kein Einzelfall. Die Sicherheit im öffentlichen Raum erodiert zusehends. Im buntesten Deutschland aller Zeiten reicht inzwischen schon eine banale Höflichkeitsbitte, um Gewalt auszulösen. Solange die Täter binnen kürzester Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt werden, wird sich an diesen unhaltbaren Zuständen nichts ändern.

