Kategorie: Nachrichten
Mutierter Reis und Bill Gates’ Laborratten: Große Experimente auf Indiens Feldern
Von Colin Todhunter
Ende 2024 löste Bill Gates in Indien Empörung aus, als er das Land in einem Podcast mit Reid Hoffman als „eine Art Labor, um Dinge auszuprobieren“ bezeichnete. Gates lobte die Stabilität Indiens und sprach von einem „Testgelände“ für globale Initiativen.
Diese Äußerung stieß auf breite Ablehnung. In den sozialen Medien brach ein Sturm der Entrüstung los. Viele Inder warfen Gates vor, ihr Land zu einem bloßen Experimentierfeld westlicher Interessen zu machen. Nutzer bezeichneten Inder als „Versuchskaninchen“ in Gates’ Labor und stellten die ethischen Grundlagen und Absichten solcher Experimente infrage.
Eine weit verbreitete Reaktion auf X fasste die Stimmung prägnant zusammen:
„Indien ist ein Labor, und wir Inder sind die Versuchskaninchen für Bill Gates. Diese Person hat alle unter Kontrolle – von der Regierung über die Oppositionsparteien bis hin zu den Medien. Sein Büro arbeitet hier ohne FCRA, und unser Bildungssystem hat ihn zum Helden gemacht! Ich weiß nicht, wann wir aufwachen werden!“
(FCRA = Foreign Contribution (Regulation) Act, regelt ausländische Spenden, um sicherzustellen, dass sie dem nationalen Interesse nicht schaden.)
Die Kontroverse lebte erneut auf, als am 5. Mai 2025 bekannt wurde, dass Indien als erstes Land zwei genmanipulierte Reissorten offiziell zugelassen hat: Kamala (DRR Dhan 100 Kamala) und Pusa DST Rice 1. Diese gelten nicht als gentechnisch veränderte (GV) Pflanzen im klassischen Sinne. Anders als bei konventionellen GVO, bei denen fremde DNA eingebaut wird, nutzen diese Sorten CRISPR-Cas-basierte SDN-1- und SDN-2-Technologien zur gezielten Veränderung bestehender Gene.
Diese Unterscheidung wird von der Agrar-Biotech-Industrie aktiv gefördert, um GV-Pflanzen regulatorisch von aufwendigen Sicherheitsprüfungen und mehrjährigen Feldversuchen zu befreien. Bereits 2022 nahm die indische Regierung solche Pflanzen aus dem Geltungsbereich der Bestimmungen über gefährliche Substanzen im Umweltschutzgesetz heraus.
Die Freistellung von GV-Pflanzen von Biosicherheitstests wirft ernsthafte Bedenken hinsichtlich möglicher Gesundheits- und Umweltrisiken auf. Auch wenn diese Technologie von der Industrie als „präzise“ angepriesen wird, ist das eher PR als Wissenschaft. Schon minimale Genveränderungen können schwerwiegende, unvorhersehbare Folgen haben. Der Harvard-Biotechnologe George Church bezeichnete CRISPR sogar als „stumpfe Axt“ und warnte vor potenziell gravierenden unbeabsichtigten Auswirkungen.
Kritiker fordern transparente, unabhängige Tests, bevor solche Pflanzen breit eingeführt werden. Die derzeitige regulatorische Ausnahmestellung in Indien wird als verfrüht und möglicherweise illegal kritisiert – insbesondere, da der Oberste Gerichtshof weiterhin die Gentechnik in der Landwirtschaft prüft. Aktivisten warnen davor, dass Biotech-Interessen erheblichen Druck auf Regulierungsbehörden ausüben, um Sicherheitsprotokolle zu umgehen und öffentliche sowie wissenschaftliche Kontrolle zu schwächen.
Obwohl diese Reissorten vom Indian Council for Agricultural Research (ICAR) entwickelt wurden, betonen zivilgesellschaftliche Gruppen – insbesondere die Coalition for a GM-Free India –, dass Gen-Editing-Technologien wie CRISPR/Cas9 firmeneigene, patentierte Verfahren sind. Dies wirft ernste Fragen zur Saatgutsouveränität und zu den Rechten der Landwirte auf. Die Patente könnten die Kontrolle großer Konzerne über die indische Landwirtschaft zementieren und das jahrhundertealte Recht der Bauern, Saatgut zu speichern und auszutauschen, untergraben.
Eigentums- und Patentrechte stehen im Zentrum der Debatte über genmanipulierten Reis in Indien. Die Diskussion geht weit über Fragen der Biosicherheit hinaus – es geht um die Autonomie der Bauern, die Kontrolle über die Lebensmittelsysteme und den zunehmenden Einfluss privater Patentinhaber gegenüber öffentlichen Institutionen.
Kritiker fordern Transparenz in Bezug auf geistiges Eigentum an den neuen Reissorten und stellen infrage, warum öffentliche Gelder des ICAR in Entwicklungen fließen, die primär Unternehmensinteressen dienen. Die mangelnde Offenlegung von Entwicklungsprozessen, Sicherheitsdaten und Eigentumsverhältnissen ist ein zentrales Problem.
Die Aktivistin Aruna Rodrigues, eine langjährige Gegnerin der Kommerzialisierung von GVO-Kulturen in Indien, warnt vor Wiederholungen früherer Fehler – etwa bei der katastrophalen Einführung von Bt-Baumwolle. Sie hat mehrfach Versäumnisse von Regulierungsbehörden offengelegt, darunter die unrechtmäßige Freigabe von herbizidtolerantem (HT) Basmati-Reis. Sie bezeichnete solche Maßnahmen als illegal und als Verstoß gegen die bestehenden GVO- und Umweltschutzgesetze (vgl. ihren Artikel Bayer liebt Basmati).
Rodrigues warnt zudem, das Vorgehen des ICAR gefährde Indiens florierenden Bio-Reis-Exportmarkt und ignoriere die Empfehlungen des vom Obersten Gerichtshof eingesetzten Technischen Expertenausschusses (TEC), der ein vollständiges Verbot von HT-Pflanzen aufgrund ihrer Umweltrisiken gefordert hatte.
Laut Rodrigues stecken die Behörden in massiven Interessenkonflikten: dieselben staatlichen Institutionen, die GV- und gene-editierte Pflanzen fördern, sind gleichzeitig für deren Regulierung zuständig – etwa das Ministerium für Wissenschaft und Technologie, das Landwirtschaftsministerium und das ICAR.
Sie sieht den gesamten regulatorischen Apparat als von Unternehmensinteressen vereinnahmt. Regierungsbehörden würden zunehmend als ausführende Organe der Biotech-Industrie fungieren.
Sowohl Rodrigues als auch die Coalition for a GM-Free India haben zahlreiche Interessenkonflikte und Regelverstöße aufgedeckt. Die TEC kritisierte bereits vor Jahren gravierende Mängel in der Bewertung biologischer Sicherheit und forderte eine Überarbeitung der Gesetzgebung – bislang ohne Konsequenzen.
Befürworter von gv-Reis wiederholen altbekannte Narrative: höhere Erträge, Hilfe gegen Hunger, Unterstützung für Bauern, Anpassung an den Klimawandel. Doch diese Versprechen sind irreführend. Sie dienen als Hebel, um das indische Ernährungssystem für Konzerninteressen zu öffnen. Die Probleme der indischen Bauern beruhen auf politischem Versagen – nicht auf mangelnder Produktivität. Agrarökologische, kleinbäuerliche Systeme bieten längst erprobte Lösungen für Klimaresistenz und stabile Erträge (vgl. Widerlegung der fehlerhaften Prämisse für die Einführung von GVO in Indien).
Die Versprechen von 25–30 % höheren Erträgen bei den neuen Sorten sind laut Bauernverbänden und zivilgesellschaftlichen Gruppen unbelegt. Es fehlen transparente, öffentlich zugängliche Felddaten. Indien produziert bereits mehr Reis, als es benötigt – ungeprüfte Ertragsversprechen rechtfertigen keine Einführung risikobehafteter gv-Sorten. Die Deregulierung von Gen-Editing ohne Biosicherheitsprüfung wird als unrechtmäßig und unwissenschaftlich bezeichnet – sie untergräbt die Glaubwürdigkeit solcher Versprechungen.
Indien kennt solche überzogenen Behauptungen bereits. Auch bei gv-Senf versprach man höhere Erträge – bis Aruna Rodrigues mit eidesstattlichen Erklärungen vor dem Obersten Gerichtshof nachwies, dass diese Behauptungen haltlos waren.
Die Kritiker werfen der Regierung vor, sich der GVO-Lobby zu unterwerfen und Genmanipulation als präzise und sicher zu verkaufen, obwohl die wissenschaftliche Literatur viele Risiken und Unsicherheiten dokumentiert (z. B. auf GMWatch.org). Indiens Zustimmung zu gv-Nutzpflanzen – unterstützt von Akteuren wie Bill Gates und kompromittierten Behörden – ist ein Beispiel für unternehmerische Vereinnahmung und regulatorische Aushöhlung.
Bill Gates, ein langjähriger Verfechter genetisch veränderter Pflanzen, traf sich im März 2025 mit Premierminister Modi – kurz vor der Ankündigung zu gv-Reis. Auch wenn das zeitliche Zusammentreffen zufällig sein mag, ist Gates’ Einfluss auf die Agrarbiotechnologie unbestritten. Indiens künftige Ernährungssicherheit und ökologische Gesundheit hängen davon ab, dass ungetestete Technologien abgewehrt und regulatorische Integrität wiederhergestellt wird – frei von unternehmerischem und pseudo-philanthropischem Einfluss.
Gates wird aufgrund seines Vermögens von Medien und Politikern oft wie ein König behandelt – doch seine Technokratie-Ideologie reduziert komplexe soziale, politische und wirtschaftliche Probleme auf scheinbar einfache technische Lösungen. Allzu oft wird dadurch bewusst ignoriert, dass echte Lösungen verdrängt und diskreditiert werden – zugunsten von Experimenten auf dem Rücken der Ärmsten, gefördert durch kooptierten Regierungen und beeinflusste Behörden.
Viele der hier behandelten Themen finden sich ausführlich in Colin Todhunters frei zugänglichem Online-Buch Power Play: The Future of Food. Gedruckte Ausgaben (Hindi & Englisch) werden derzeit von Bagha Books an zivilgesellschaftliche Gruppen, Bildungseinrichtungen und interessierte Leser in Indien verteilt.
Erzbischof Vigano: Der historische Kampf zwischen Gut und Böse tritt in seine Endphase ein
In einem Interview mit dem ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon erklärte Erzbischof Carlo Maria Vigano, dass Papst Benedikt XVI. im Jahr 2013 zum Rücktritt gezwungen und durch Jorge Mario Bergoglio – also Papst Franziskus – ersetzt worden sei. Dieser stammt aus den Reihen des sogenannten Tiefen Staates und folge dessen Befehlen. Franziskus sei somit ein illegitimer Papst, so Vigano, der ihn als „Bauchrednerpuppe von Davos“ bezeichnete.
Die Wahl von Franziskus sei, laut Vigano, von amerikanischen Deep-State-Strukturen und der sogenannten St. Gallen-Mafia manipuliert worden – einem geheimen Netzwerk aus Bischöfen und Kardinälen.
Vigano spricht von einem „Putsch der pädophilen Elite“, in den Persönlichkeiten wie Barack Obama, Hillary Clinton, John Podesta und Mitglieder der Biden-Familie verwickelt seien. Er forderte die neue US-Regierung auf, diese Vorgänge zu untersuchen und aufzuklären, in welchem Ausmaß frühere Regierungen beteiligt waren.
Ein orchestrierter Angriff auf die christliche Ordnung
Dieser Putsch, so Vigano, sei Teil eines größeren, global koordinierten Umsturzes, der von der Woke-Linken und dem Weltwirtschaftsforum betrieben werde. Ziel sei es, jeglichen Widerstand gegen die Errichtung einer Neuen Weltordnung zu brechen. „Diese Verbrecher stehen im Dienst des Antichristen. Es geht um nichts Geringeres als das Reich des Antichristen“, sagte er.
Der Erzbischof betonte, dass derzeit ein historischer, spiritueller Kampf zwischen Gut und Böse stattfinde – zwischen Gott und Satan. Und dieser gehe nun in seine entscheidende Phase über. Die Feinde Christi, so Vigano, hätten sich in der Freimaurerei organisiert, die er als antichristlich und satanisch bezeichnete. Das erklärte Ziel: die vollständige Auslöschung der christlichen Gesellschaft, Kultur und Zivilisation.
Der Teufel, so Vigano weiter, sei durch das Kreuzesopfer Christi auf Golgatha besiegt worden – doch nun nehme er Rache, indem er versuche, so viele Seelen wie möglich mit sich in den Abgrund zu reißen.
Die moralische Zersetzung als strategisches Ziel
Um dieses Ziel zu erreichen, sei Satan auf mehreren gesellschaftlichen Ebenen aktiv: in Familie und Bildung, in Kultur und Unterhaltung, in Wissenschaft und Finanzwelt. Seine Absicht sei es, die Menschheit moralisch so weit zu korrumpieren, dass das Gute kaum noch erkennbar oder lebbar sei.
„Unsere Führer haben uns verraten“, sagte Vigano. „Wir werden ersetzt – durch eine Elite aus UNO und EU, durch eine forcierte Islamisierung. Wer sich gegen das kriminelle Verhalten der neuen Barbaren ausspricht, landet im Gefängnis.“
Doch das sei nicht das Ende der Geschichte. Vigano warnte: Muslime, die mit dem Ziel nach Europa kämen, die Scharia einzuführen, übersähen einen dritten Akteur – eine übergeordnete Macht, die bewusst ethnisch-religiöse Spannungen zwischen Christen und Muslimen schüre. Ziel sei es, bürgerkriegsähnliche Zustände in westlichen Ländern herbeizuführen, um damit weitere Einschränkungen von Freiheit und Grundrechten zu rechtfertigen.
Die größten Erfolge und größten Misserfolge der Trump-Administration bisher
Brandon Smith
Im Jahr 2016 sagte ich Donald Trumps erdrutschartigen Wahlsieg gegen Hillary Clinton voraus – trotz Stimmen, die mich als verrückt bezeichneten. Die Kritiker argumentierten, das Establishment würde Trump niemals ins Amt lassen. Doch meine Einschätzung war einfach: Die konservative, populistische Bewegung war zu stark, um ignoriert zu werden, und die Globalisten würden ein Trump-geführtes Weiße Haus nicht als Totalverlust betrachten, solange sie es hinter den Kulissen steuern oder durch eine nationale Krise sabotieren konnten.
Im Jahr 2020 war Trump mitten in den inszenierten BLM-Unruhen und einer erfundenen Pandemie gefangen – ausgelöst durch ein Virus mit einer Überlebensrate von 99,8 %. Die Wahl im November wurde de facto zugunsten von Joe Biden manipuliert: durch fragwürdige Briefwahlverfahren, durch das Verschwinden von Millionen solcher Stimmen bis 2024, durch das Unterdrücken wichtiger Nachrichten und die Zensur konservativer Meinungen in sozialen Medien. All das ebnete Biden den Weg ins Amt.
Es gab jedoch auch Fehler Trumps, die seine Chancen verringerten und den Enthusiasmus konservativer Wähler dämpften. Ich selbst war seiner ersten Amtszeit gegenüber kritisch eingestellt – vor allem wegen der „Sumpfkreaturen“, die sein Kabinett fluteten.
Um fair zu bleiben: Trump begab sich in eine Höhle voller Schlangen. Er war von Leuten umgeben, die seine Politik kontrollieren und seine Wiederwahl sabotieren wollten. Bei Tausenden potenzieller Kabinettsposten vertraute er den falschen Personen.
In seiner zweiten Amtszeit ist Trumps Neustart der Bundesregierung hingegen geradezu episch. Ich habe weit weniger zu kritisieren, auch wenn es weiterhin ernsthafte Probleme gibt.
Werfen wir zunächst einen Blick auf seine größten Erfolge im ersten Quartal. Nicht jeder wird jeden Punkt als „Erfolg“ ansehen – aber wie man sagt: Der Terrorist des einen ist der Freiheitskämpfer des anderen.
Sieg Nr. 1: Vollständige Beendigung der illegalen Einwanderung
Ein unbestreitbarer Erfolg. Viele behaupteten, Trump werde die Grenze niemals sichern oder konsequent abschieben. Sie lagen falsch.
Nur einen Monat nach Trumps Amtsantritt gingen illegale Grenzübertritte nahezu auf null zurück. Die Border Patrol, zuvor mit monatlich 50.000 bis 300.000 Fällen beschäftigt, verzeichnet jetzt nur noch rund 8000 Begegnungen pro Monat – der niedrigste Stand in der Geschichte.
Ein Rückgang um 95 % seit Trumps Amtsantritt. Das ist historisch. Die Medien schweigen weitgehend dazu, weil Kritiker diesen Erfolg nicht für sich reklamieren können.
Der Einbruch zeigt, dass die meisten Migranten nicht vor Tyrannei fliehen, sondern wegen Geld und Sozialleistungen kommen. Früher überlaufene Grenzstädte auf mexikanischer Seite sind jetzt Geisterstädte. Es gab keine humanitäre Krise, sondern einen von Demokraten, NGOs und der UNO geförderten Betrug.
Sieg Nr. 2: DOGE schließt USAID und andere Sabotage-Agenturen
Die DOGE von Elon Musk liefert gemischte Ergebnisse, aber die Schließung korrupter Agenturen wie USAID ist ein starkes Signal.
USAID war mit linken NGOs verflochten und betrieb weltweit „Woke“-Kulturimperialismus. Durch großzügige Subventionen für linke Aktivisten und Ausschluss konservativer Programme veränderten sie Gesellschaften nach ihrem Weltbild.
Inzwischen wirkt die Woke-Bewegung wie im Todeskampf. Proteste schrumpfen, Unternehmen rücken von ihrer Agenda ab, Online-Trolls verschwinden. Ein Wandel ist spürbar.
Sieg Nr. 3: Zoll-Kampagne
Noch ist es früh für eine endgültige Bilanz, aber erste Erfolge sind sichtbar. Das Vereinigte Königreich akzeptierte 10 % Zölle und senkte seine Abgaben auf US-Waren auf 1 %. Amerikanische Produkte können nun ungehindert nach Europa exportiert werden.
China befindet sich wirtschaftlich in Not und zeigt Bereitschaft zu Verhandlungen. Internationale Firmen verlagern ihre Produktion in die USA.
Wenn Trump mehr Fabriken heimholt, steigt das Angebot, die Preise sinken, Jobs im mittleren Segment entstehen. Sein Plan, die Einkommenssteuer durch Zolleinnahmen zu ersetzen, könnte die Menschen von der Abhängigkeit von IRS und Fed befreien.
Sieg Nr. 4: Entfernung von LGBT/DEI-Propaganda aus Schulen und Institutionen
Trumps Drohung, woken Schulen Bundesmittel zu streichen, zeigt Wirkung. Lehrer beklagen sich in sozialen Medien über das Entfernen von Trans- und BLM-Symbolik. Wie diese Ideologie überhaupt ins Bildungssystem gelangen konnte, bleibt eine offene Frage für Generationen.
Psychisch instabile Trans-Aktivisten werden aus dem Militär entfernt. Viele suchten dort nur kostenlose Hormonbehandlungen. Sie untergruben die Glaubwürdigkeit der Streitkräfte. Gut, dass sie gehen.
Sieg Nr. 5: Freiheit für die Gefangenen vom 6. Januar
Kaum jemand glaubte daran, doch es geschah. Die Darstellung der Demokraten war unehrlich. Videos zeigen, wie die Capitol Police Tränengas und Gummigeschosse gegen friedliche Demonstranten einsetzte. Die Unruhen wurden provoziert.
Einige Teilnehmer nahmen Souvenirs mit oder beschädigten Eigentum, doch die drakonischen Strafen waren politisch motiviert. Trump begnadigte sie zu Recht.
Jetzt zu den Misserfolgen:
Fehlschlag Nr. 1: Aufdeckung wirtschaftlicher Manipulation unter Biden
Trump gelang es nicht, die Fälschung von Wirtschaftsdaten durch die Biden-Regierung deutlich zu machen. Diese log über Inflation, BIP und Jobs. Wenn die Wahrheit ans Licht kommt, könnte Trump dafür verantwortlich gemacht werden.
Ein öffentlich sichtbarer Wirtschaftsbeauftragter, der Missstände aufdeckt und Fortschritte erklärt, wäre dringend notwendig.
Fehlschlag Nr. 2: Veröffentlichung der Epstein-Akten
Ein PR-Desaster. Generalstaatsanwältin Pam Bondi versprach Enthüllungen, lieferte aber nur Bruchstücke. Statt einer klaren Liste über Verdächtige gibt es nur Verzögerungen.
Das FBI hatte Jahre Zeit für Ermittlungen. Das Zögern lässt vermuten, dass eine Veröffentlichung zu gravierenden politischen Erschütterungen führen würde.
Fehlschlag Nr. 3: Auslandshilfe für Israel
Trotz „America First“-Rhetorik bleibt Israels jährliche Milliardenhilfe bestehen. Dabei braucht Israel das Geld nicht. Konsequent wäre, auch hier Subventionen zu streichen.
Fehlschlag Nr. 4: Militärhilfe für die Ukraine
Der Ukraine-Krieg ist keine US-Angelegenheit. Ein Ende der Hilfen würde Verhandlungen erzwingen. Trump muss klare Grenzen setzen und Hilfe an Friedens- und Handelsbedingungen knüpfen.
Fehlschlag Nr. 5: Real ID und biometrische Erfassung von US-Bürgern
Das Bush-/Obama-Relikt Real ID ist ein weiterer Schritt Richtung Überwachungsstaat. Biometrie für Inlandsflüge ist unnötig und gefährlich. Trump könnte Bundesstaaten ermutigen, sich dagegen zu wehren.
Fazit:
Trumps zweite Amtszeit ist deutlich stärker als seine erste. Mit klarer Kommunikation, Distanz zu Auslandskonflikten und einer harten Linie gegen Überwachung könnte er als einer der bedeutendsten Präsidenten der Moderne in die Geschichte eingehen.
EXKLUSIV: 35 Menschen starben am selben Tag, an dem sie ihre Covid-„Impfung“ erhielten. Die Behörden leiteten keine Ermittlungen ein.
Diese exklusive Untersuchung wurde in Zusammenarbeit mit Canberra Daily veröffentlicht.
Australiern wird regelmäßig versichert, dass Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-Impfung extrem selten seien. Die Arzneimittelbehörde behauptet, nur 14 Todesfälle im Zusammenhang mit über 70 Millionen verabreichten Impfdosen festgestellt zu haben.
Mehr als tausend andere Todesfälle, die der Sicherheitsüberwachungsdatenbank DAEN (Database of Adverse Event Notifications) der Therapeutic Goods Administration (TGA) gemeldet wurden, gelten allgemein als Zufälle. Die TGA bestärkte diese Auffassung, indem sie immer wieder betonte: „Die meisten Todesfälle, die nach einer Impfung auftreten, sind nicht auf den Impfstoff zurückzuführen.“
Darüber hinaus vermittelt die TGA den Eindruck, dass alle gemeldeten Todesfälle gründlich untersucht würden, wenn sie erklärt: „Die TGA überprüft alle Todesfälle, die in den Tagen und Wochen nach der COVID-19-Impfung gemeldet werden, sorgfältig.“
Neue, durch das Gesetz über Informationsfreiheit (FOI) veröffentlichte Dokumente, die Canberra Daily vorliegen, legen jedoch nahe, dass die Öffentlichkeit in die Irre geführt wurde.
Entgegen der weit verbreiteten Annahme zeigen die Dokumente, dass die TGA nicht jeden gemeldeten Todesfall im DAEN gründlich untersucht – selbst dann nicht, wenn der Tod am selben Tag wie die Impfung eintrat.
Canberra Daily kann offenlegen, dass von 35 Berichten über Australier, die am Tag ihrer Covid-Impfung verstarben, die TGA lediglich bei 24 Personen eine Kausalitätsbewertung vornahm. Für die übrigen elf Todesfälle liegt kein solcher Bericht vor.
Keiner dieser 35 „Tag-0“-Todesfälle wurde an die Vaccine Safety Investigation Group (VSIG) weitergeleitet – ein Expertengremium, das bei den schwerwiegendsten Nebenwirkungen nach einer Impfung (AEFI) einberufen werden soll, insbesondere wenn das Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs infrage steht oder das öffentliche Vertrauen gefährdet ist.
In der Korrespondenz mit der TGA konnte Canberra Daily zudem bestätigen, dass die Behörde einen Zusammenhang zwischen der Impfung und der überwiegenden Mehrheit der gemeldeten Todesfälle nie ausgeschlossen hat.
Die TGA geht vielmehr grundsätzlich davon aus, dass jeder gemeldete Todesfall möglicherweise mit der Impfung zusammenhängt – auch wenn in öffentlichen Erklärungen regelmäßig das Gegenteil behauptet wird.
Die Wissenschaftlerin Dr. Suzanne Niblett, die durch FOI-Anfragen die 35 „Tag-0“-Todesfälle aufgedeckt hat, bezeichnete die Enthüllungen als „unglaublich“ und „unentschuldbar“.
„Die ständige Behauptung, es habe nur 14 impfbedingte Todesfälle gegeben, ist höchst irreführend, wenn man bedenkt, dass über tausend andere Todesfälle nie ordentlich untersucht wurden“, sagte Dr. Niblett gegenüber Canberra Daily.
Sie beschreibt die Sicherheitsüberwachung der TGA als „Black Box“ und betont, dass es mehrere FOI-Anfragen über viele Monate hinweg brauchte, um Informationen zur „Zeit bis zum Tod“ nach der Impfung zu erhalten.
Neben den 35 Todesfällen am Impftag stellte Dr. Niblett fest, dass in den Fällen mit verfügbaren Zeitangaben einer von vier Todesfällen innerhalb von drei Tagen nach der Impfung eintrat.
39 % der Todesfälle ereigneten sich innerhalb einer Woche, 86 % innerhalb von sechs Wochen. Dieser enge zeitliche Zusammenhang sei nicht ignorierbar, so Dr. Niblett.
„Der zeitliche Zusammenhang ist ein zentrales Kriterium, wenn es darum geht, einen kausalen Zusammenhang zwischen einem Medikament und einer unerwünschten Reaktion zu prüfen“, sagte sie. Ihre Ergebnisse werden in Zusammenarbeit mit der Australian Medical Professionals Society und weiteren Gesundheitsfachkräften veröffentlicht.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bestätigt in ihren Leitlinien, dass zeitlicher Zusammenhang ein wichtiges Kriterium bei der Kausalitätsprüfung ist – wenngleich er nicht automatisch eine Kausalität beweise.
Besonders besorgniserregend ist für Dr. Niblett, dass bei 25 % der gemeldeten Todesfälle nach Covid-Impfung keine Informationen über den Todeszeitpunkt vorlagen.
„Man sollte annehmen, dass man solche Angaben zwingend nachverfolgt“, sagte sie. „Wie will die TGA Todesfälle zuverlässig prüfen, wenn solche grundlegenden Daten fehlen?“
Ein Sprecher der TGA erklärte gegenüber Canberra Daily:
„Alle der TGA gemeldeten Todesfälle werden sorgfältig daraufhin überprüft, ob der Impfstoff eine Rolle gespielt haben könnte. Dabei wird die Stärke der Beweislage berücksichtigt.“
„Ziel ist nicht, jeden Zusammenhang auszuschließen, sondern zu klären, ob klinische Gegebenheiten, die zum Tod führten, ein neues Sicherheitssignal darstellen.“
„Die Todesursache wird von Gerichtsmedizinern und behandelnden Ärzten bestimmt – nicht von der TGA.“
Einberufungen der VSIG erfolgen nur, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind – etwa das Fehlen anderer plausibler Todesursachen sowie ausreichend detaillierte Berichte.
Da 73 % der Todesmeldungen von medizinischem Personal oder Gesundheitsbehörden stammten, ist es unwahrscheinlich, dass triviale Erklärungen wie Autounfälle zutrafen – besonders bei Todesfällen am Impftag oder kurz danach.
Dies deutet darauf hin, dass fehlende Informationen der Grund dafür waren, dass keine VSIGs einberufen wurden. Auf Nachfrage erklärte die TGA:
„Wenn zusätzliche Daten für die Bewertung notwendig sind, fordern wir diese vom Melder, der zuständigen Behörde oder vom Gerichtsmediziner an. Aber nicht alle Anfragen führen zu neuen Informationen.“
In einer weiteren E-Mail bestätigte die TGA, dass auch Fälle ohne Kausalitätsbericht oder VSIG-Einberufung als „sorgfältig geprüft“ gelten.
Was genau unter dieser Prüfung verstanden wird, bleibt unklar – insbesondere, da viele Angehörige berichten, nie von der TGA kontaktiert worden zu sein.
Der in Sydney lebende Sportphysiologe Leon Anderson erklärte, die TGA habe weder den plötzlichen Tod seines 30-jährigen Bruders Matt im Oktober 2021 sechs Wochen nach der AstraZeneca-Impfung weiterverfolgt, noch den Bericht des Hausarztes berücksichtigt.
„Obwohl der Arzt eine Kopie des Berichts hatte, sagte die TGA, sie habe keine Aufzeichnung darüber“, so Anderson in einer unveröffentlichten Eingabe zur Senatsuntersuchung über Übersterblichkeit 2023.
„Als ich darauf hinwies, schlug man mir lediglich vor, den Bericht einfach erneut einzureichen – ohne ein Wort darüber, dass das Meldesystem offenbar Berichte verlieren kann.“
Obwohl die TGA keine Obduktionen vorschreibt, veranlasste Matts Familie eine Autopsie. Doch die Todesursache blieb „ungeklärt natürliche Ursache“.
„Der Pathologe sagte, es habe keine Anzeichen einer impfstoffinduzierten Thrombozytopenie (VITT) gegeben – das Hauptthema bei AstraZeneca zu jener Zeit“, so Anderson. Er kritisiert die hohe Schwelle für den Nachweis eines Zusammenhangs, als es noch kaum Forschung über Impfnebenwirkungen gab.
Ein Kausalitätsbericht zu einem „Tag-0“-Todesfall nach einer Booster-Impfung lautet, eine Verbindung sei „unwahrscheinlich“, da die Impfung nicht mit der Todesursache verknüpft worden sei.
„Laut TGA gibt es vier weitere Todesmeldungen zu derselben Impfstoffcharge wie bei Matt“, erklärte Anderson. Darunter zwei weitere junge Männer, 29 und 30 Jahre alt.
„Diese Charge war mit über 160 Meldungen über Nebenwirkungen und über 50 schweren Schäden verbunden – meist kardial oder thrombotisch.“
Dennoch teilte die TGA mit, sie werde keine weiteren Untersuchungen durchführen, da nur „begrenzte Informationen“ über Matts Todesursache vorlägen.
Sein Fall zählt nun zu den 1.034 Meldungen, die laut TGA „sorgfältig geprüft“, aber nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht wurden.
Anderson arbeitet mit Dr. Niblett an der Studie zur Todeszeit. Seine Erfahrung wirft Zweifel auf, wie viele der 1.048 gemeldeten Todesfälle (Stand 25. April) tatsächlich gemäß WHO-Standards kausal geprüft wurden.
Dr. Rado Faletič, Direktor von COVERSE, einer Organisation für Impfgeschädigte, sagte: „Es überrascht nicht, dass die TGA diese Todesfälle nicht untersucht hat.“
„In unserer Gemeinschaft gibt es keinen einzigen Fall, in dem ein Todesfall nach der Impfung von der TGA weiterverfolgt wurde – obwohl viele Betroffene weiterhin unter teils schweren Impfschäden leiden, die ihre Ärzte als impfbedingt einstufen.“
Die von Dr. Niblett gesammelten Daten zur schnellen Symptomentwicklung spiegeln sich auch bei COVERSE wider:
„Etwa die Hälfte der Betroffenen entwickelte innerhalb von 24 Stunden schwere Symptome – z. B. Myokarditis“, sagte Faletič gegenüber Canberra Daily.
Er kritisiert, dass die TGA das rasche Auftreten solcher Symptome nicht ernster nehme und die Öffentlichkeit nicht transparenter informiere.
Faletič fordert staatlich finanzierte Forschung zu schweren AEFI-Fällen sowie eine angemessene Entschädigung.
Das australische Covid-Entschädigungsprogramm wurde im September 2024 eingestellt – nur 418 von 4.941 Anträgen (8,4 %) wurden genehmigt. 1.057 waren bei Schließung noch offen – der Rest wurde abgelehnt oder zurückgezogen.
Eine Sammelklage mit über 2.000 Impfgeschädigten gegen die Regierung könnte nun der letzte Ausweg sein.
Die Intransparenz der TGA trage maßgeblich zum Vertrauensverlust in Impfungen und Gesundheitssysteme bei, so der Artikel. Ein Schritt hin zu echter Offenheit wäre dringend notwendig – nicht nur für Gerechtigkeit, sondern auch für das Vertrauen der Bevölkerung.
Doch können sie es sich leisten, es nicht zu tun?
Milliarden gespritzt – und jetzt das
Toxikologe warnt vor mRNA-Impfstoffen – und die Behörden? Schweigen.
Von der Wissenschaft gefeiert, von der Politik gepusht, vom Mainstream kritiklos verteidigt – doch nun bricht das Kartenhaus mRNA-Impfung langsam zusammen.
Ein neuer Artikel auf TrialSite News schlägt hohe Wellen: Ein erfahrener Toxikologe erhebt schwere Vorwürfe gegen die Konstruktion und Zulassung der mRNA-Impfstoffe. Seine Diagnose: toxisch, mangelhaft geprüft – und von Behörden fahrlässig durchgewinkt. Während Millionen Menschen unter unerklärlichen Symptomen leiden, bröckelt jetzt auch die letzte Bastion des Narrativs „sicher und wirksam“.
Die Warnung kommt spät – zu spät!
Der zentrale Kritikpunkt des Artikels ist alarmierend: Die Lipid-Nanopartikel (LNPs) – Trägersysteme der mRNA – könnten selbst toxisch sein und starke Entzündungsreaktionen im Körper auslösen. Noch gravierender ist: Diese potenziell schädlichen Komponenten wurden offenbar nie umfassend langzeitgetestet, bevor sie an Milliarden Menschen verimpft wurden.
Die Kritik trifft nicht nur die Hersteller. Auch die Aufsichtsbehörden wie FDA und EMA stehen am Pranger. Laut dem Toxikologen wurden grundlegende Sicherheitsstandards ignoriert, alternative Prüfansätze verworfen und langfristige Beobachtungsstudien unterlassen.
„Wir haben ein medizinisches Massenexperiment erlebt – ohne echten Sicherheitsgurt.“
– so fasst ein beteiligter Experte die Lage nüchtern zusammen.
Schweigen, Zensur, Kollateralschäden
Jene, die frühzeitig gewarnt haben, wurden verspottet, gelöscht oder gesellschaftlich ausgegrenzt. Medien, die heute von Impfnebenwirkungen berichten, verweigerten jahrelang jede kritische Debatte. Ärzte, die Impfgeschädigte behandelten, wurden unter Druck gesetzt. Studien, die auf Gefahren hinwiesen, verschwanden in der Versenkung oder wurden als „Fehlinformation“ diffamiert.
Und nun? Langsam, zäh und unter wachsendem öffentlichem Druck beginnen einige Institutionen zurückzurudern. Man prüfe, so heißt es jetzt plötzlich, ob mRNA-Impfungen bei Kindern überhaupt noch sinnvoll seien – ein Eingeständnis, das millionenfaches Leid im Nachhinein nicht ungeschehen machen kann.
Ein Skandal historischen Ausmaßes
Dass erst jetzt – nach unzähligen Impfschäden – ernsthaft über Konstruktionsfehler, Entzündungsrisiken und toxische Wirkstoffe diskutiert wird, ist ein Schlag ins Gesicht für alle Betroffenen. Viele leiden seit Monaten oder Jahren an chronischer Erschöpfung, Herzproblemen, Nervenschmerzen, Thrombosen oder Autoimmunreaktionen – ohne Anerkennung, ohne Hilfe, ohne Entschädigung.
Stattdessen heißt es: „Die Impfstoffe haben Leben gerettet.“
Eine bequeme Ausrede – und ein zynischer Trost für jene, deren Gesundheit geopfert wurde.
Was jetzt?
Was dieser Artikel deutlich macht:
Das Kapitel mRNA-Impfung ist noch lange nicht abgeschlossen. Es ist vielmehr ein Lehrstück über Kontrollverlust, Arroganz, blinden Fortschrittsglauben und systemisches Versagen auf allen Ebenen.
Was fehlt, ist nicht die nächste Booster-Kampagne – sondern:
Fazit:
Es ist eine medizinische, politische und moralische Sauerei, dass man erst jetzt beginnt, sich mit den strukturellen Problemen dieser Impfstoffe auseinanderzusetzen – nachdem Milliarden Menschen zum Versuchslabor gemacht wurden.
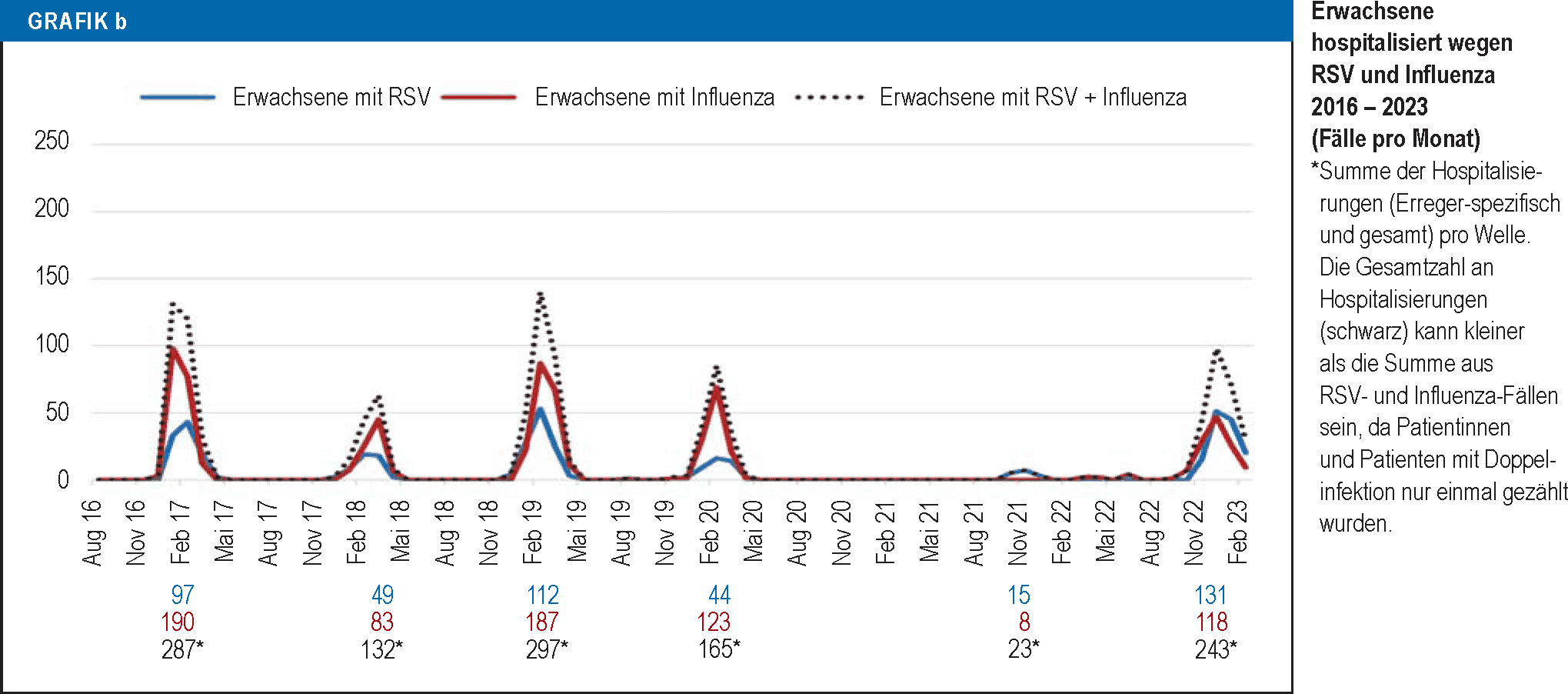
Wirksamer als Impfungen: „Covid-19“
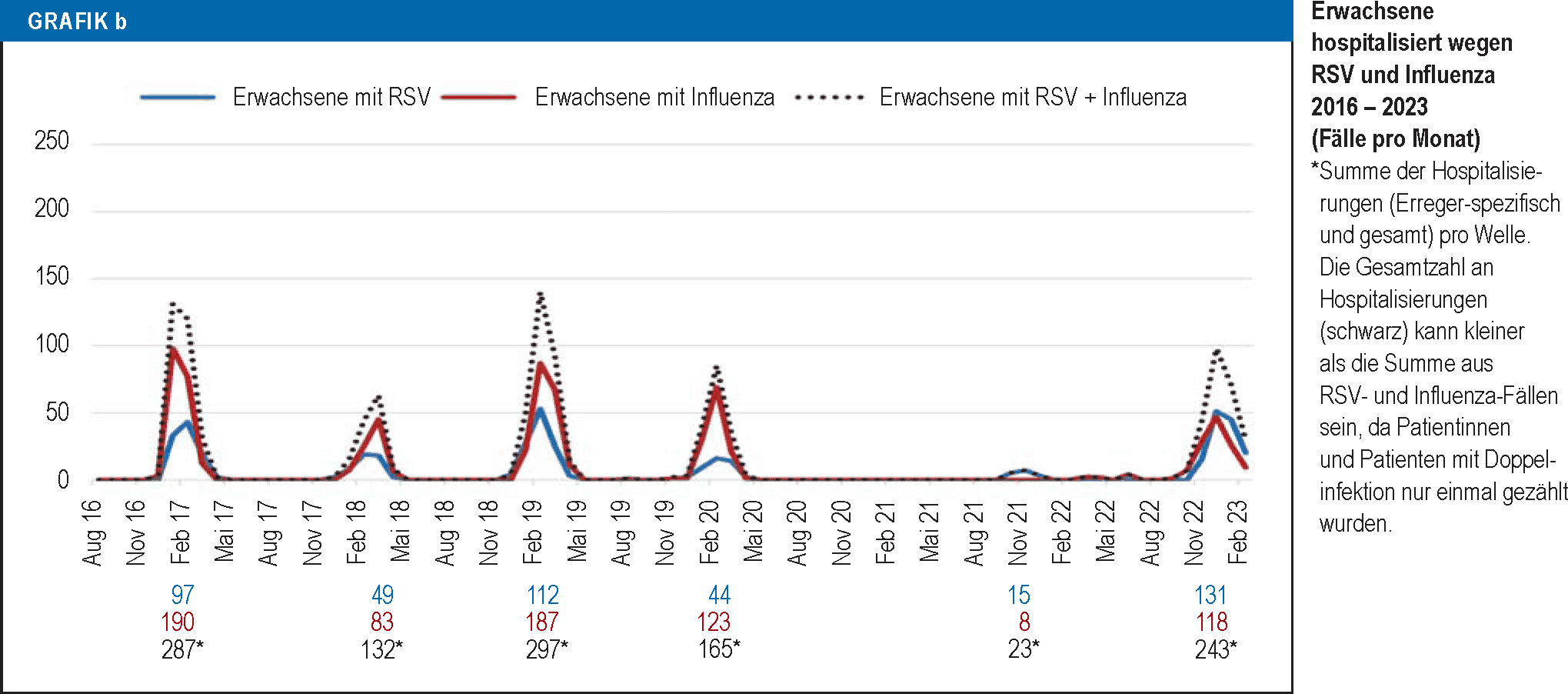
Nach offiziellen Bekundungen sollen Impfungen Infektionskrankheiten zum Verschwinden bringen. Gelungen ist dies nur, wenn man mit Einführung einer Impfung die Krankheiten umbenennt. So geschehen bei den Pocken oder der „Polio“. Die Pocken firmieren jetzt als Alaskapocken oder MPox und „Polio“ heißt jetzt „schlaffe Lähmung“ oder „Guillain-Barré“-Syndrom. Dennoch wird das Narrativ vom Impfschutz unbeugsam weitererzählt. Aktuell […]
Der Beitrag Wirksamer als Impfungen: „Covid-19“ erschien zuerst unter tkp.at.
»VERTUSCHT«: Anders Breivik – Massenmörder und FREIMAURER!
Wenn der Spiegel über die neue russische Doku über Putin berichtet…

Russisch lernen – Lektion 83 von 100
anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Russisch lernen – Lektion 83 von 100
Sprache ist der Schlüssel – vor allem zur Völkerverständigung. Sie gehören auch zu den Menschen, die gerne Russisch lernen möchten und nicht wissen, wo Sie anfangen sollen? Sie haben das Gefühl, die russische Sprache ist viel zu kompliziert? Macht Ihnen das kyrillische Alphabet Angst, und sind Sie unsicher, ob Sie die richtige Aussprache jemals meistern werden? Wünschen Sie sich, im Urlaub oder im Gespräch mit Muttersprachlern Russisch sprechen zu können, ohne dabei in endlose Theorie abzutauchen? Wenn der Gedanke ans Lernen bisher nur Stress und Unsicherheit bei Ihnen ausgelöst hat und Sie endlich einen einfachen und effektiven Weg suchen, Russisch zu lernen, dann bietet wir Ihnen ab sofort die perfekte Lösung! Wir haben weder Kosten noch Mühen gespart und in den vergangenen sechs Monaten einen insgesamt 100 Lektionen umfassenden Russisch-Kurs produziert. Und das Beste daran: Jedes einzelne dieser Lernvideos ist kostenlos für Sie auf unserer Internetseite abrufbar. Wissen sollte frei sein und dieser Kurs ist unser Dankeschön an unsere Leser für über 10 Jahre Treue und Unterstützung.
Der Beitrag Russisch lernen – Lektion 83 von 100 ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

Klima-Schwindel: Das Eis der Antarktis nimmt zu
anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert

Klima-Schwindel: Das Eis der Antarktis nimmt zu
Ende März berichtete die „Tagesschau“ noch unverdrossen, das der Rückgang des Meereises sich fortsetzt. Die Daten zeigen indes das Gegenteil. Wann gibt es hierzulande einen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik – und der Klimaberichterstattung?
von Fritz Vahrenholt
Schaut man auf die Klima-Website der Helmholtz-Gesellschaft mit dem anspruchsvollen Namen „Klimafakten“ unter Antarktis nach, so liest man Folgendes: „Das wichtige Festland-Eis der Antarktis schwindet, und zwar in zunehmendem Tempo“. Dies hätte, so die Helmholtz-Gesellschaft, eine große Bedeutung für den steigenden Meeresspiegel. Und tatsächlich ist der durch das schmelzende Eis der Antarktis steigende Meerespiegel eines der zentralen Argumente der Klimapolitik, die die Menschen beunruhigt haben.
Umso überraschender ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie, wonach sich seit 2021 das Bild gewandelt hat: Das Festlandeis der Antarktis nimmt wieder zu. Chinesische Forscher der Tongji-Universität um Prof. Shen und Dr. Wang ermittelten, dass seit 2021 die Eismassen der Antarktis in sehr starkem Maße zugenommen haben. Die ausgewerteten Daten des NASA-Satelliten GRACE hatten von 2002 bis 2010 einen jährlichen Verlust von 74 Milliarden Tonnen pro Jahr festgestellt. Von 2011 bis 2020 verdoppelte sich die Menge sogar. Nun nahm das Eis Jahr für Jahr um etwa 108 Milliarden Tonnen zu. (siehe diese Grafik Science China Press)
Da das Abschmelzen der antarktischen Gletscher mit etwa 20 Prozent zum Meeresspiegelanstieg beitrug, stellt man nun seit 2021 eine Abschwächung des Anstiegs fest. Wäre diese gute Nachricht es nicht wert, in der Tagesschau verbreitet zu werden? Bislang Fehlanzeige.
Eine zweite gute Nachricht wird ebensowenig von der Tagesschau und dem politischen Berlin verbreitet: Seit über 10 Jahren nimmt das arktische Meereis nicht mehr ab. Darauf aufmerksam gemacht hat eine kürzlich erschienene Veröffentlichung von Mark England von der Universität Exeter und Lorenzo Polvani von der Columbia Universität in New York. Die Forscher berichten von einer zu erwartenden jahrzehntelangen Pause des Rückgangs des arktischen Meereises. Sie erwarten es zumindest für die nächsten 5–10 Jahre.
Noch im Jahre 2009 hatte John Kerry, US-Klimabeauftragter, Alarm geschlagen, dass in 2013 die Arktis eisfrei werden würde. Die Realität entwickelte sich anders (siehe diese Grafik der NASA).
Durch Satellitenmessungen ist der Rückgang des arktischen Meereises bis 2012 gut dokumentiert, aber ebenso die anschließende Stabilisierung und leichte Erholung. Zum Vergleich wird jeweils das jährliche Septemberminimum herangezogen. Nach der starken Erwärmung der letzten Jahre war ein erneuter Rückgang erwartet worden. Aber das Meereis bleibt stabil. Diese eindeutigen Messdaten hinderten die Tagesschau am 28. März 2025 nicht daran, zu berichten, dass sich der Rückgang des Meereises fortsetzt, mit schwerwiegenden Folgen für das Klimasystem. Und für solche Falschinformationen, die offenbar politischen Zwecken dienen, bezahlen wir immer noch Rundfunkgebühren.
Die Klimawissenschaft in der Krise?
Immer häufiger weichen die Prognosen der Klimamodelle von der Realität ab. Axel Bojanowski hat zwei Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Meteorologie in Hamburg zu Wort kommen lassen. Prof. Bjorn Stevens und Prof. Jochem Marotzke sprechen von einer Krise der Klimawissenschaften. Marotzke: “Die gegenwärtige Klasse von Klimamodellen gerät in zu viele Widersprüche mit der Wirklichkeit“. Kopfzerbrechen macht Marotzke die große Unsicherheit der Modelle. Als Beispiele führt er an: „In großen Teilen der Welt widersprechen sich die Modelle in der Frage, ob es künftig mehr oder weniger regnen wird. Die Erwärmung der Erdoberfläche zwischen 1998 und 2012 verlief deutlich langsamer als von den Modellen vorhergesagt (“Hiatus”). Seit 1979 hat sich der tropische östliche Pazifik abgekühlt, entgegen den Erwartungen aller Modelle, die dort eine Erwärmung simulieren.“ Marotzke spricht mit Blick auf die Klimawissenschaft von „der anderen Klimakrise“. „Dies sei der Moment für einen Paradigmenwechsel“.
Mein Eindruck ist: Einige kluge Wissenschaftler merken jetzt, dass sie die Politik mit dem Hinweis auf die unerschütterlichen Aussagen der Klimamodelle dazu gebracht haben, viel Unglück über ihre Völker zu bringen, weil man zu schnell, mit völlig unangemessenen Maßnahmen, die vor der Tür stehende Katastrophe vermeiden wollte. Man wird sich an die Aussagen der UNO erinnern: „Nur erneuerbare Energien seien die Ausfahrt vom Highway zur Klimahölle“ (Guterres). Oder „Emissionen von Treibhausgasen haben eindeutig die globale Erwärmung verursacht, wobei die globale Oberflächentemperatur 2011–2020 um 1,1°C über den Wert von 1850–1900 lag. (Weltklimarat IPCC 2023, Synthesis report A1).
Basis dieser Aussagen sind Klimamodelle, für die wir jetzt, laut Marotzke, einen Paradigmenwechsel benötigen, weil sie die Realität schon nach wenigen Jahren nicht mehr hinreichend genau wiedergeben. Wann gibt es hierzulande einen Paradigmenwechsel in der Klimapolitik ?
Der Beitrag Klima-Schwindel: Das Eis der Antarktis nimmt zu ist zuerst erschienen auf anonymousnews.org – Nachrichten unzensiert und wurde geschrieben von Redaktion.

